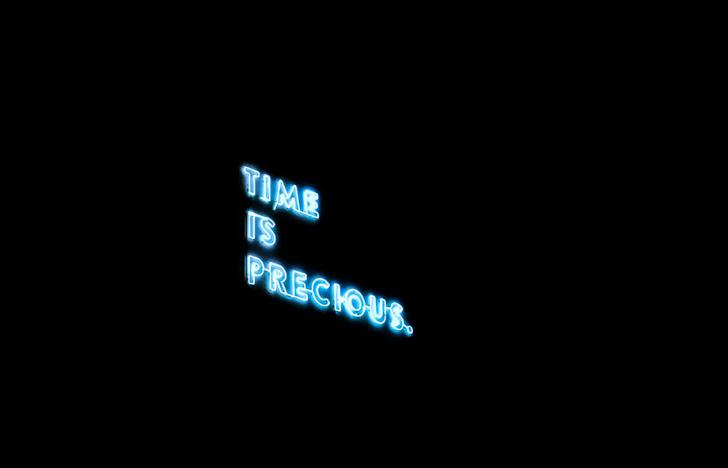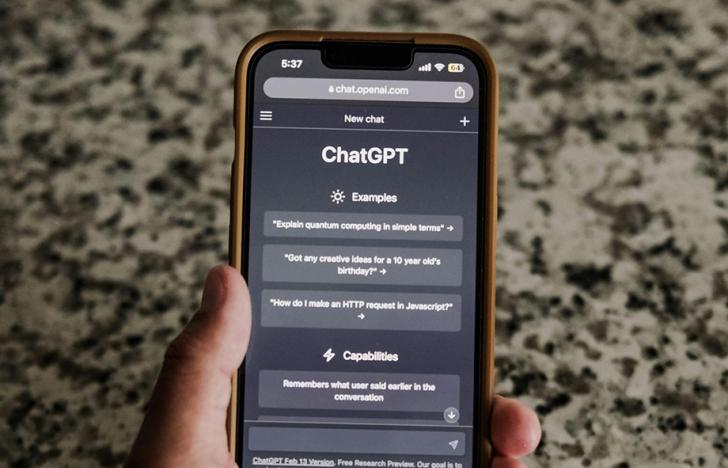Sozialkapital reloaded

Der Begriff „Sozialkapital“ reiht sich nahtlos an jenen vom „Humankapital“. Ob die drohende weltweite Rezession seine „Karriere“ stutzen oder ihm Flügel verleihen wird, bleibt eine spannende Frage.
Sozialkapital ist ein schillernder, durchaus nicht unumstrittener Modebegriff, der als Platzhalter verwendet wird, in den alle soziokulturellen Faktoren hineinprojiziert werden, die wirtschaftlich relevant sein könnten. Bei Sozialkapital handele es sich, so der US-Sozialwissenschaftler Francis Fuku-yama „um informelle Normen, die die Kooperation zwischen zwei oder mehr Individuen befördern. Die gesellschaftlichen Normen, die das Social Capital ausmachen, beinhalten das Verhaltensprinzip der Gegenseitigkeit zwischen zwei Freunden bis zu den komplexen und elaboriert ausformulierten Dok-trinen des Christentums oder des Konfuzianismus.“
Sozialkapital offenbart sich also darin, wie viel Vertrauen Menschen anderen, ihnen fremden Personen entgegenbringen, in welchem Maße sie in der Lage sind, private, zwischenmenschliche Netzwerke zu knüpfen und zu pflegen und wie stark sie sich als Bürger in Vereinen, Clubs, Parteien, Verbänden, Kirchen und sonstigen Glaubensgemeinschaften engagieren. Ernst Gehmacher, OECD-Beauftragter für Sozialkapital und wissenschaftlicher Leiter des Büros für angewandte Sozialforschung (BOAS) in Wien, sieht im Sozialkapital eine neue Technik und Antwort der Demokratie auf die Krise der modernen Welt. Das Instrument diene dazu, die aktive Gesellschaft in ihrer eigenen Entwicklung zu stärken und besser auf realistische Ziele auszurichten. Für ihn ist das von Grenzgängern zwischen Soziologie und Ökonomie geprägte Mischwort ein Begriff der Vermittlung: „Kitt der Gesellschaft“ nennt er es.
Kitt der Gesellschaft
Das Wort selbst sei nur ein neuer Name für etwas Uraltes: die Kraft der Gemeinschaft. Diese Naturkraft hat unzählige Erscheinungsformen und Bezeichnungen: Liebe, Treue, Verbundenheit, Freundschaft, Beziehung, Begeisterung, Glaube, Solidarität – immer steht dahinter die Gefühlsbindung zu Menschen, zu Gemeinschaften, zu Idealen.
„Die Kraft dieser sozialen Gefühle und Ideen bewegt Menschen stärker als Geld, motiviert sie zu Leistung und Opfer, macht sie gesund oder krank“, so Gehmacher. Die derzeitige Modernisierung und Globalisierung wertet er als „eine Phase der kulturellen Evolution“, die „in ihrer Dynamik und Bedeutung dem Übergang von den Sammler- und Jägerkulturen zu Ackerbau und Viehzucht und damit zu den hierarchischen Standeskulturen vergleichbar ist“ –
oder auch „dem Durchbruch der europäischen Bürgerkultur aus der feudalen Standesordnung zur weltweiten Dominanz von Marktwirtschaft und Demokratie“ gleiche.
Die Anerkennung der Nachhaltigkeit, auch dieser Begriff ist mit 19,3 Mio. Treffern bei Google ein echter Hit, als „alles überwölbendes Prinzip“ sei Voraussetzung für einen „evolutionären Quantensprung in der menschlichen Zivilisation“.
Eine neue Nachhaltigkeitskultur müsste vor allem auf Verkehr und Mobilität, Wohnen, Bildung, Lebensqualität, Umwelt, Gesundheit, Fitness und Wellness ausgerichtet sein. Zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitskultur gehört die Wirkkraft der Gemeinschaft, das Sozialkapital. Die Parameter, mit denen man Sozialkapital misst, mögen umstritten sein, das OECD-Projekt „Measuring Social Capital“ ergab für Österreich jedenfalls ein ernüchterndes Ergebnis: Vor 20 Jahren war der Kitt der Gesellschaft noch intakt, derzeit bröckelt er schon – und die Auflösung geht weiter.
Die Antwort auf die Frage nach den Chancen einer globalen Ethik liegt also bei jedem von uns. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun – mit der Konsequenz, ob wir ein Teil des Problems sein wollen oder ein Teil der Lösung.