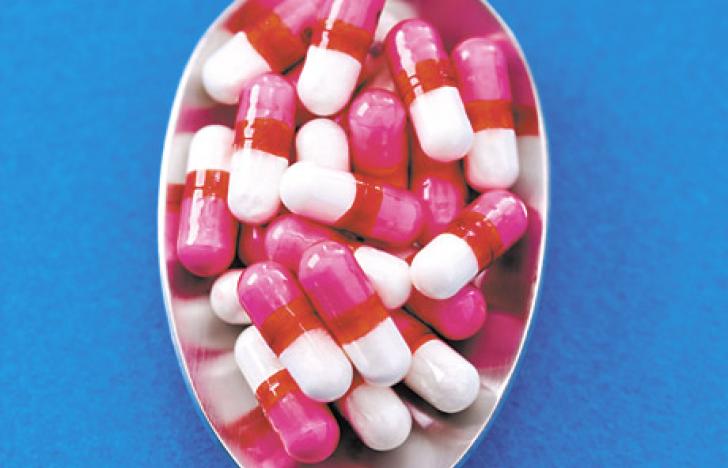Wenn die Uni aus dem Internet kommt
 Bilderbox.com
Bilderbox.comGeht es nach Verfechtern der Open-Course-Ware-Idee, könnten Kurse an Universitäten in Zukunft frei abrufbar sein. Bereits über 200 Hochschulen bieten ihre Materialien kostenlos im Internet an.
Es sind nur ein paar Klicks, und die Inhalte einer Lehrveranstaltung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cam-bridge (USA) öffnen sich auf dem Computer-Bildschirm in Österreich. Kursaufbau, Skript, Leseliste und Videomitschnitt können angesehen werden. Nichts Außergewöhnliches eigentlich. Besonders wird diese Tatsache jedoch dadurch, dass die Materialien anders als beim E-Learning frei, also ohne Registrierung, zugänglich sind.
Open Course Ware nennt sich die Idee, universitäre Unterrichtsmaterialien der weltweiten Internet-Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Bezahlt wird dafür nichts. Die Unterlagen dienen lediglich der Information, Prüfungen können keine abgelegt werden. Das MIT in Cambridge ist Vorreiter dieser Entwicklung. 1800 Kurse finden sich auf der Open-CourseWare-Website der Eliteuniversität (http://ocw.mit.edu). Was vor acht Jahren als Pilotprojekt begann, hat sich mittlerweile zu einem eigenen, nicht kommerziell ausgerichteten Unternehmen entwickelt. Aus 500 abrufbaren Kursen wurden 1800. Die Lehrmaterialien können genutzt, verändert und weiterverbreitet werden. Eine Creative-Commons-Lizenz macht die Inhalte frei zugänglich, ohne dass Urheber dabei ihr geistiges Eigentum verlieren.
Initiative von Studierenden
„Je mehr Wissen offen zugänglich ist, desto mehr Menschen können sich damit befassen und die Richtigkeit überprüfen“, schreiben Rebecca Kampl und Barbara Hofmann in ihrem Beitrag zu Open Course Ware in dem Band Freie Netze. Freies Wissen. Das vor zwei Jahren anlässlich der Kulturhauptstadt Linz erschienene Buch hat an der Linzer Johannes Kepler Universität zur Weiterbeschäftigung angeregt – vorerst wird das Projekt allerdings nur von Studierenden betrieben.
50 Skripten werden dort auf der Website der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) angeboten. „Wir wollen einen freien Zugang zu Wissen und Bildung schaffen“, sagt Denise Rudel, Sozialwirtschaft-Studentin und Open-Course-Ware-Sachbearbeiterin. In einem nächsten Schritt sollen die Skripten durch MP3-Audiodateien ergänzt werden.
Derzeit steckt die Open-Course-Ware-Initiative an der Kepler Universität allerdings noch in ihren Anfängen. In ein bis zwei Jahren wollen die Projektverantwortlichen neben Skripten auch Videomitschnitte von Seminaren und Vorlesungen auf die Website laden. Momentan gilt es aber vor allem, Professoren und Lektoren davon zu überzeugen, ihre Materialien zur Verfügung zu stellen. „Wir arbeiten beständig daran. Die häufigsten Argumente gegen das Projekt sind Skepsis am Schutz des geistigen Eigentums und die Tatsache, dass die Lehrbeauftragten bereits bei einem Verlag unter Vertrag sind“, erklärt Denise Rudel.
Vorreiter Klagenfurt und Linz
Dass nicht ein Großteil der Kursunterlagen auf der Open-Course-Ware-Plattform direkt von den Lehrenden kommt, ist ein Punkt, in dem sich das Linzer Projekt von seinen Vorgängern wie dem des MIT unterscheidet. „Ich schätze das Engagement der Kollegen in Linz sehr, aber derzeit ist das Projekt noch mehr ein Ansatz zu Open Educational Resources. Open Course Ware bedeutet, einen ganzen Kurs als geschlossene Sache abzuhandeln und nicht nur die Skripten davon zu veröffentlichen“, sagt Thomas Pfeffer, Soziologe und Open-Course-Ware-Verantwortlicher an der Alpen Adria Universität Klagenfurt.
Die Universität in Klagenfurt war die erste Hochschule im deutschen Sprachraum, die sich der Idee der Open Course Ware angenommen hat. Bislang ist sie auch die Einzige geblieben, die im internationalen Open-Course-Ware-Konsortium vertreten ist. Über 200 Universitäten sind darin weltweit verzeichnet. Kriterium für die Aufnahme ist neben der Veröffentlichung von mindestens zehn Online-Kursen ein institutionelles Bekenntnis zur Open Course Ware. Ein Punkt, bei dem sich die ÖH der Linzer Kepler Universität noch schwertut. Derzeit wird das Open-Course-Ware-Projekt ohne offizielle Unterstützung der Hochschule von den Studierenden betrieben.
Thomas Pfeffer von der Klagenfurter Universität bezeichnet diese Tatsache als großes Manko der Universitäten: „Die Hochschulen bieten das Lehrmaterial nicht selbst an, und die Studierenden springen dann für sie in die Bresche. Das ist sehr löblich, aber sie machen dadurch den Job, den die Unis oder die Lehrenden erledigen sollten.“ Gemeint ist damit auch die Veröffentlichung von Skripten, die von Studenten in Foren und auf diversen Websites online gestellt werden, sowie kommentierte Vorlesungsverzeichnisse, die nicht von institutioneller Seite, sondern direkt von der Studierendenvertretung kommen.
In Klagenfurt wird seit 2005 an der Entwicklung von Open Course Ware gearbeitet. Die Inhalte sind dort über das E-Learning-Angebot Moodle abrufbar. Eine Lösung, mit der Thomas Pfeffer noch nicht hundertprozentig zufrieden ist. „Optimal wäre die Weiterentwicklung zu semitransparenten Kursen, von denen nur bestimmte Teile wie Abläufe, Leselisten oder Powerpoints veröffentlicht werden“, sagt er.
Chance für Lehrende
Neben der Möglichkeit für Studierende, sich schon vorab Einblick in ein Studium und in Kurse verschiedenster Fachrichtungen zu verschaffen, stecke in der Idee der Open Course Ware auch eine große Möglichkeit für die Lehrenden an den Unis selbst, so Pfeffer. Eine verstärkte Transparenz der universitären Lehre und eine Förderung des wissenschaftlichen Austauschs werden dadurch bedingt, dass die Open-Course-Ware-Materialien völlig frei zugänglich sind.
„Wenn ich heute sehen möchte, was ein Kollege macht, müsste ich mich in der Regel für seinen Kurs anmelden. Deswegen findet da auch sehr wenig Austausch statt“, erklärt der Open-Course-Ware-Verantwortliche. Dass die Zukunft der Universitäten in der Veröffentlichung von Lehrmaterialien im Internet liegt, ist sich Pfeffer sicher: „Aber auch beim Buchdruck hat es einige Zeit gedauert, bis sich dieser durchgesetzt hat.“