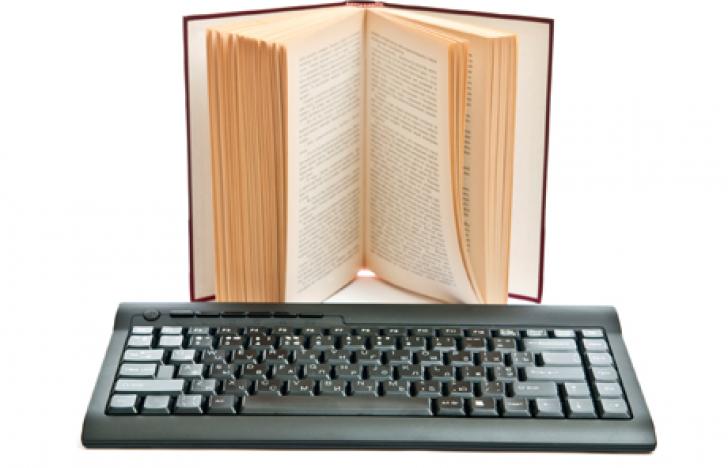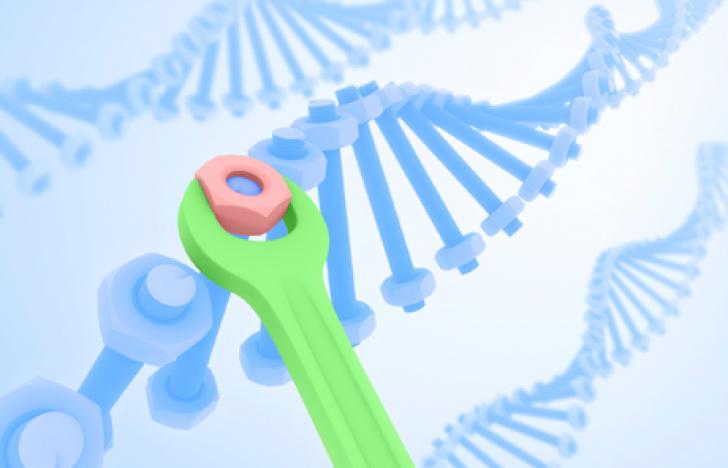Innovativ und halbwegs seriös
 Andy Urban
Andy UrbanEines der ersten Internet-Start-ups gründen, klassische Dotcom-Fehler, Innovation in Österreich, das Unternehmerleben zwischen Abgrund und internationalem Erfolg und österreichische Lokalkaiser. Der österreichische Entrepreneur Oliver Holle im Gespräch mit economy.
Die Internet-Zeitrechnung beginnt mit 1989, als Tim Berners-Lee das WWW am Institut CERN in Genf entwickelt. Oliver Holler gründet 1992 mit 22 Jahren das erste Start-up im Bereich Internet-Dienstleistungen, baut mit 28 Jahren das Unternehmen mit Venture-Capital aus, kauft dann alle Anteile wieder zurück und gründet 2004 mit zwei anderen kleinen Unternehmen im Bereich Mobile Medien 3united. 2006 folgt schließlich der Verkauf an die amerikanische Veri Sign um rund 55 Mio. Euro. Anstatt am heimatlichen Wörthersee Wasserski zu fahren, gibt der erfolgreiche Entrepeneur nun mit seiner Firma The Merger seine Erfahrungen weiter.
economy: Wie kam es zu diesem Betätigungsfeld, und wie war das Umfeld in Ö seinerzeit? Damals konnte es ja passieren, dass Visionären ein Arzt empfohlen wurde.
Oliver Holle: 1992 gab es kein Internet in Ö, sondern nur CD-Rom-Multimedia in kleinen überschaubaren Zirkeln, von Silicon Valley oder weltweiten Geschäften noch keine Spur. Bei uns war es eine Studentenfreundschaft, die sich langsam in ernsthafte Projekte und dann letztlich mit dem Dotcom-Boom 1999 in eine große wirtschaftliche Opportunity entwickelte. Damals galt es, sich zu entscheiden. Wir waren sehr früh dran und entsprechend attraktiv für Investoren.
In der Historie von Sysis zeigt sich, dass die weitere Unternehmensentwicklung 1999 über Venture-Capital (VC) passiert ist. Welche Erfahrungen hast du dabei in Ö gemacht? Warum VC und nicht Forschungsförderung?
Wir haben immer beides versucht, wobei Forschungsförderung ohne Eigenkapital nur bedingt möglich ist und vor allem nur bis zur Produkteinführung läuft. Die teure, kritische Phase, in den Markt zu gehen, bleibt unfinanziert, insofern hatte man mit einer Nischenpositionierung wie Sysis damals gar keine andere Wahl als VC oder eine Bankenfinanzierung. Zweiteres gab es nicht wirklich, also blieb nur VC. Wir waren zum richtigen Zeitpunkt da, und es war eigentlich sehr einfach, wenn man innovativ und halbwegs seriös war.
VC wurde auch für die Internationalisierung verwendet. Innerhalb kurzer Zeit wurde in D, US und UK expandiert. Welche Herausforderungen sind bei einer derart raschen vertrieblichen Expansion zu beachten?
Marc Andreessen schreibt, dass viele Start-ups overventured sind und deswegen zu früh expandieren, bevor es einen eigentlichen Produktmarkt gibt. Das war bei uns auch so, und daran sind wir fast zugrunde gegangen. Weiters haben wir im ersten Anlauf alle klassischen Dotcom-Fehler gemacht: zu teures Vertriebspersonal mit nur klassischer Verkaufserfahrung, die über ein Jahr lang nix verkauften, bevor man sich von ihnen trennte. Teure Niederlassungen vor Ort, bevor langfristige Kundenbeziehungen da waren. Viel besser lief es im zweiten Anlauf mit 3united: Wir haben ein starkes Management in Österreich aufgebaut, damit sich das Gründerteam hundertprozentig auf strategischen Vertrieb und Internationalisierung konzentrieren konnte.
Auch der Mitarbeiterstab wuchs entsprechend rasch. Welche Erfahrungen gab es damit?
Bevor es kein funktionierendes mittleres Management gibt, bringt Wachstum nichts. Wenn schon, dann muss man versuchen, funktionierende Teams einzukaufen, auch wenn man Anteile abgeben muss.
Mitten in die Wachstumsperiode kam dann ab 2001 der Dotcom-Crash, und genau in der Phase haben die Sysis-Gründer ihre VC wieder ausgekauft. Hatten diese Angst um ihr Investment oder war das beabsichtigt?
Der Auskauf kam erst später, 2002, nachdem Sysis über zwei Jahre quasi am Abgrund entlanggelebt hat. Zu dem Zeitpunkt musste sich für das Gründerteam etwas am Anreizsystem ändern, um weiter dieses Risiko zu fahren, und dem haben die Investoren zugestimmt.
Du hast mit Sysis 2001 den Staatspreis für Multimedia und E-Business gewonnen. Hatte das positive Auswirkungen, und wenn ja, welche?
Es war auf jeden Fall positiv, vor allem für das Selbstbewusstsein des Teams, und ein bisschen auch im offiziellen Österreich. Schade dabei war nur, dass dies einem Produkt – nämlich dem Xmas Agent – galt, dem 2001 durch die Dotcom-Blase der Markt vollständig weggebrochen ist.
Andererseits war die Technologie hinter dem Xmas Agent das Toolkit, das später die Basis für die weltweite Ericsson-Kooperation war.
Wie würdest du den Standort Ö in seiner Entwicklung im Bereich F&E und Innovation sowie Unternehmensgründung – auch rückblickend – beschreiben?
Sehr gut mit Förderungen ausgestattet in der Forschungsinnovationphase und in der Produktentwicklung, aber dann das große Finanzierungsloch für die Gründungsphase. Es gibt kaum Banken, kaum Venture-Capital-Geber und vor allem auch keine heimische Industrie, die es gewohnt ist, von lokalen Start-ups Innovation zu kaufen oder gar Innovation via M&A (Anm.: Mergers & Acquisitions) umzusetzen. Das ist der wesentliche Unterschied zu den USA. Positiv hat sich trotz allem das Start-up-Umfeld entwickelt. Es gibt ein klares Verständnis, wie Hightech-Start-ups vor allem in den USA funktionieren: als ausgelagerte Research & Development und Innovationsabteilung für globale Konzerne mit den entsprechenden Benchmarks, Entwicklungspfaden und Selbstbildern. Also weg vom klassischen österreichischen Modell des lebenslangen Firmengründers, der dann im eigenen Revier Lokalkaiser wird und das irgendwann mal vielleicht seinen Kindern übergibt.
Gibt es mittlerweile eine ausreichend funktionierende VC-Szene bzw. genügend Geld und genügend öffentliche F&E-Förderungen?
Wie schon gesagt, VC für Gründungsphasen gibt es kaum, das vorhandene Privatkapital hat auch davor Angst, weil es an unternehmerischem Verständnis fehlt und weil man hier das Silicon Valley-Modell nicht verinnerlicht hat. Es fehlen Vertrauensbeziehungen, Netzwerke und Brückenbauer. Förderstellen wie AWS und FFG machen einen guten Job, um Unternehmen in die Höhe zu bekommen. Aber die große Frage ist die Anschlussfinanzierung – da gibt es auch von dort noch keine klaren Antworten. Im österreichischen IKT-Bereich würde ein gut gemanagter Fonds von fünf bis zehn Mio. Euro Startkapital schon wirklich etwas bewegen und erfolgreich sein.
Was würdest du jungen österreichischen Start-ups raten?
Ich kann nur für den IKT-Bereich reden. 1. Orientiere dich von Beginn an mit deiner Idee an den Weltmarktführern bzw. an den Top-Start-ups. Der Abstand ist technisch heutzutage allemal einholbar, insofern gibt es für viele Bereiche auch keinen Ö/D/EU-Markt mehr. 2. Such dir Top-Partner, auch wenn es dich Anteile kostet. Alles was die Erfolgswahrscheinlichkeit hebt, ist es wert. 3. Der Chef und Gründer geht verkaufen, alles andere geht die ersten zwei Jahre schief. 4. Nicht geizig sein, hart arbeiten. Und den eigenen Bullshit nicht glauben. (lacht) ϑ
Nun zu deinem aktuellen Betätigungsfeld mit der Firma The Merger. Du hast Uma und System One zusammengebracht, Barbara Meyerl schrieb im Format von einem „Heiratsvermittler für Technologiefirmen“. Was kann man sich unter deinem neuen Unternehmen vorstellen?
Fakt ist, dass hier viele Unternehmen ein gutes Produkt und oft auch schon positives Marktfeedback, aber keinen Zugang zu klassischem Wachstumskapital haben. Was wir bei 3united selbst erlebt haben und aktuell beim Merger von System One und Uma, ist ein alternativer Pfad, der meiner festen Überzeugung nach schneller und für den Gründer effektiver zum Ziel führen kann: Wir finden passende Hightech-Unternehmen, die sich in Technologie, Kultur und Team ergänzen, und bauen Firmen, die die kritische Grenze der Technologie, der Kunden etc. international überschreiten. Diese Firmen sind dann nicht nur hervorragend positioniert, um aus eigener Kraft zu wachsen, sondern sie sind auch attraktive Kaufobjekte. Unser zweiter Bereich ist ein Standort im Silicon Valley, wo wir ausgewählten Start-ups eine Brücke ins US-Geschäft anbieten, mit Büro, Appartment und Netzwerk vor Ort. Wikitude nutzt dies bereits erfolgreich, andere sind gerade am Sprung.
SMS wurde als die letzte „Killer-Applikation“ gerühmt. Wo liegen deiner Meinung nach zukünftige Killer-Applikationen?
Im Internet. Die Trennung mobil oder PC verschwimmt. Das Web hat gewonnen.
Wie ist das Innovationsklima in Ö aus deiner Sicht, gibt es noch Sysis-Storys?
Im mobilen Bereich haben Telefongesellschaften dieses Innovationsgeschäft vernachlässigt und sich auf ruinöse Preiskämpfe verlagert. Das schadet auch der österreichischen Start-up-Szene. Die meisten Firmen in meinem Portfolio haben ihre wichtigsten Kunden im Ausland.
Was muss seitens der Politik passieren?
Hier könnte eine innovative öffentliche Einkaufspolitik viel bewegen. Die Stadt Wien setzt erste positive Schritte, soweit ich weiß. Sysis-Storys wird es wieder geben, an den ersten sind wir dran. ϑ
Wie schaut der österreichische Mobilfunk in zehn Jahren aus?
Er wird Teil globaler Netzwerke und somit gleichgeschaltet mit anderen Märkten sein. Hoffentlich kann sich die Telekom Austria als eigenständiger Akteur weiter behaupten. Allgemein nimmt die Rolle der Netzbetreiber eher ab. Mit Apple und Android haben sie ihr Distributionsmonopol für innovative Anwendungen verloren. Das wird sich weiterführen, intelligente Betreiber werden nicht dagegen arbeiten, sondern sich mit Zusatzangeboten komplementär positionieren.
Economy Ausgabe 86-08-2010, 27.08.2010
 privat
privat