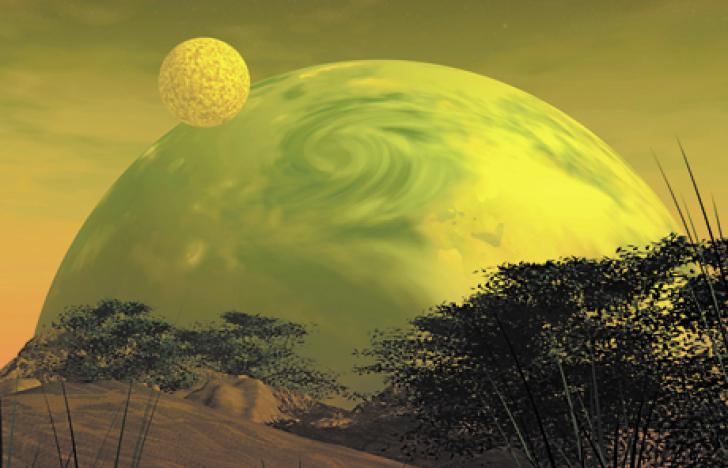Alle Informationen am Spitalsbett
 Bilderbox.com
Bilderbox.comClaudia Maurer: „Damit Ärzte und Pflegepersonal effizient arbeiten können, brauchen sie eine mobile Kommunikationslösung. Und sie müssen direkt am Krankenhausbett auf alle benötigten Informationen zum Patienten zugreifen“, erklärt die Kapsch-Expertin für das Gesundheitswesen.
economy: Frau Maurer, Krankenhäuser gelten als das Paradebeispiel für die sinnreiche Anwendung fortschrittlicher Kommunikationslösungen. Warum?
Maurer: Ganz einfach weil eine moderne Großkrankenanstalt eine der komplexesten Organisationen ist, die es gibt. Zum einen durch den hohen Grad an Arbeitsteilung: Da arbeiten Ärzte verschiedenster Disziplinen gemeinsam mit dem Pflege- und Laborpersonal. Das führt insgesamt zu einem enormen Informations- und Kommunikationsbedürfnis. Denn die eine Hand muss wissen, was die andere tut. Zum anderen erfolgen die Prozesse und Dienstleistungen zum größten Teil vor Ort – direkt beim Patienten.
Wie wirkt sich das auf die Kommunikationsbedürfnisse des medizinischen Personals aus?
Sie werden Ärzte selten am Schreibtisch antreffen. Ein Bereitschaftsarzt legt auf seinen Runden im Krankenhaus täglich etwa neuneinhalb Kilometer zurück. Eine Krankenschwester schafft drei bis fünf Kilometer pro Tag. Die Mitarbeiter eines Krankenhauses sind also hochmobil. Genauso mobil muss ihre Kommunikationslösung sein.
Was, wenn nicht?
Dann führt unstrukturierte Kommunikation zu sichtbaren Ineffizienzen. Ein einfaches Beispiel: Ein Patient teilt einer Schwester mit, dass er Schmerzen hat. Die Schwester will das neue Symptom mit einem Arzt abklären, erreicht ihn aber nicht. Der ruft zwar etwas später zurück, da ist die Schwester dann schon wieder beim Patienten und ihrerseits nicht erreichbar.
Ständige Erreichbarkeit sorgt also für weniger Stress beim Personal.
Nicht nur das. Medizinische Prozesse sind oft zeitkritisch, eine verzögerte Reaktion kann den Behandlungserfolg beeinträchtigen. Und wenn die Kommunikation nicht funktioniert, kommt es leicht zu Missverständnissen – und die sind wiederum eine häufige Ursache für Fehlbehandlungen.
Also müssen alle Mitarbeiter mobil erreichbar sein?
Das ist nur ein Bestandteil einer optimalen Kommunikationslösung. Nehmen wir noch mal das zuvor genannte Beispiel: Der Arzt kann den Anruf der Schwester nicht annehmen, weil er gerade operiert. Wenn die Schwester das weiß, kann sie ihm je nach Dringlichkeit entweder eine E-Mail schreiben oder sich an einen anderen Arzt wenden.
Wie erfährt sie, ob dieser Arzt erreichbar ist?
Der Arzt kann seinen Präsenzstatus festlegen. Die Schwester sieht dann, welcher Arzt gerade erreichbar ist und wie – per Telefon, Textnachricht oder E-Mail. Damit erspart sie sich vergebliche Kontaktversuche. Und diese übersichtliche Darstellung der Verfügbarkeit der Ärzte bringt gerade in Notsituationen wertvolle Minuten.
Wie können sie das medizinische Personal noch unterstützen?
Um den Patienten bestmöglich betreuen zu können, muss der Zugriff auf das Krankenhausinformationssystem direkt am Patientenbett erfolgen, um die Krankengeschichte einzusehen, um einen Behandlungsraum zu buchen. Dabei ist die technische Lösung zweitrangig – das könnte etwa ein Tablet-PC sein, aber der Fernseher im Patientenzimmer eignet sich ebenso gut.
Im Landesklinikum Baden-Mödling (siehe nebenstehenden Artikel) wurde in einer sehr speziellen Situation ein Videokonferenzsystem installiert. Welche Nutzungsmöglichkeiten bieten sich für Telekonferenzen darüber hinaus an?
Es ist dadurch zum Beispiel nicht immer notwendig, dass die Patienten herkommen. Mit Teleambulanzen können wir ihnen lange Anfahrtswege ersparen. Auch gibt es etliche Krankheiten, die sehr selten sind, und es kommt deswegen häufiger vor, dass es im Wohnort des betroffenen Patienten keinen auf diese Krankheit spezialisierten Arzt gibt. In einer Telekonferenz jedoch kann die Meinung eines Spezialisten ohne große Umstände eingeholt werden, selbst wenn der in Übersee sitzt.