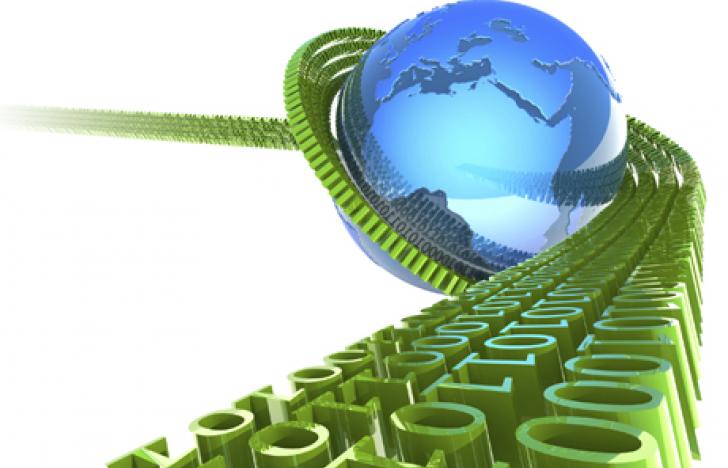Die Stimme der Marginalisierten
 Augustin
AugustinRobert Sommer: „Es gibt bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die sich nicht gut artikulieren können, und die werden bei uns privilegiert behandelt. Die bekommen bei uns eine Plattform und eine Ausdrucksmöglichkeit, die sie sonst nicht haben“, sagt der Mitbegründer des Augustin.
economy: Warum gibt es in den angeblich so reichen Industrieländern so viele arme Menschen?
Robert Sommer: Es gibt so etwas wie ein Gesetz, das man nennen könnte: „The winner takes it all.“ Die, die oben sind, werden immer reicher, und die, die unten sind, werden immer ärmer. Nun ist aber zum Beispiel die Utopie der Europäischen Union eine Angleichung der Verhältnisse. Aus diesem Grund sei die EU gegründet worden, hat man den Menschen gesagt. In Wirklichkeit wird der Unterschied zwischen den Billiglohnländern und den reichen Ländern immer größer.
Und damit der Wunsch der Armen, am Reichtum teilzuhaben?
Ja. Gerade Wien ist ein ganz besonderer Magnet für osteuropäische Armutsflüchtlinge. In unserer Zeitung Augustin versuchen wir immer wieder zu erklären, warum diese Menschen, die meisten arme Schlucker, nach Wien kommen. Es gibt osteuropäische Länder, in denen der Mindestmonatslohn gerade einmal 100 Euro beträgt. In Österreich gibt es eine kollektivvertragliche Übereinkunft, der zufolge er mindestens 1000 Euro ausmachen soll. In anderen westeuropäischen Ländern liegt dieser Mindestlohn pro Monat sogar bei 1600 Euro. Dieses Gefälle bringt die Leute zu uns.
Die westeuropäischen Länder scheinen ihren Wohlstand aber verteidigen zu wollen.
Die meisten Medien behaupten ja, die Menschen im Osten seien selber schuld an ihrer Misere. Wir versuchen aber zu informieren, welchen Anteil wir selbst an diesem Zustand haben; dass österreichische Unternehmen, die ihre Produktion in diese Länder auslagern, ein Interesse daran haben, dass diese Dumping- und Sklavenlöhne dort bestehen bleiben. Zum Beispiel wurde soeben bekannt, dass der Swarovski-Konzern Teile der Produktion in Wattens in Tirol abbauen und ins Ausland verlagern wird. Insofern sind wir mit schuld an dieser Kluft, denn die Unternehmen könnten ja auch einen Beitrag leisten, diese Kluft zu vermindern, indem sie annähernd österreichische oder zumindest Kompromisslöhne zahlen. Aber es wird weiterhin zu tschechischen oder rumänischen Löhnen produziert und zu westeuropäischen Preisen verkauft.
Würdest du auch sagen, dass diese Auslagerung der Produktion in Billiglohnländer so etwas wie eine neue Form von Kolonialismus ist?
Das kann man so sagen. Da gibt es auch ein aktuelles internationales Beispiel. Das neue iPad von Apple wird von dem taiwanesischen Unternehmen Foxconn in einer südchinesischen Wanderarbeiterfabrik produziert. Dort gab es eine Welle von Selbstmorden unter der Belegschaft, die vielfach auch als Folge der menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und des enormen Drucks, unter dem die rund 300.000 Beschäftigten stehen, gesehen wird. Die Leute dort arbeiten in Zwölfstundenschichten, sechs Tage die Woche, und erhalten dafür nur den staatlichen Mindestlohn von umgerechnet 105 Euro im Monat. Übrigens: Anlässlich der Einführung des iPad auf dem deutschen Markt veröffentlichte Der Standard die Liste „Elf Dinge, die dem iPad das Genick brechen werden“. Da ging es aber nur um technische Features, von den Produktionsbedingungen stand dort kein Wort.
Du meinst, diese Zusammenhänge werden von den anderen Medien nicht transportiert?
Wir setzen uns intensiv mit dem sogenannten Qualitätsjournalismus auseinander. Es ist für mich meist interessanter, mich mit dem Standard zu beschäftigen als mit der Kronen Zeitung. Es ist ja bekannt, wie die Krone schreibt, aber Zeitungen wie Der Standard haben einen anderen Anspruch. Deswegen wundere ich mich oft, wie systemkonform sie schreiben. Wir sehen den Augustin auch als ein Medium, der diesen kolportierten Mythen und dem Mainstream-Journalismus substanziell etwas entgegensetzt und alternative Informationen in bestimmten Bereichen liefert.
Ihr seid da offensichtlich sehr praxisorientiert, theoretische Kritik am Neoliberalismus liest man bei euch eher selten.
Aber gerade jetzt haben wir die Kolumne von Dr. Ehalt, der sich damit sehr wohl theoretisch auseinandersetzt. Er sagt immer: „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.“ Wir haben zum Beispiel jetzt Journalisten beauftragt, die Raiffeisenbank genauer zu beobachten, weil es in Österreich kein Medium und keinen Journalismus gibt, die die Geschäfte der wahrscheinlich einflussreichsten Bank des Landes transparent machen. Es gibt da eine Untersuchung über die mächtigsten Leute Österreichs, und da findet man unter den ersten fünf gleich vier Leute von Raiffeisen. Das ist natürlich eine gewaltige Macht, die auch einen Großteil der Zeitungen kontrolliert. Ich weiß nicht, ob economy auch darunterfällt.
Meines Wissens nicht. Aber nochmals zum modernen Kolonialismus: Da gibt es ja auch bei der laufenden Fußball-WM einige Beispiele.
Ja, da hast du recht. Nehmen wir den Jabulani genannten offiziellen Ball; da hat die Organisation „Südwind“ einiges recherchiert. Für den Massenmarkt wird er in Indien in einer Billigversion hergestellt und händisch genäht. Die Näherinnen erhalten rund 20 Cent pro Ball und schaffen gerade einmal vier Stück pro Tag. Davon kann man nicht einmal in Indien leben. Mittlerweile wurden einige Betriebe sogar geschlossen und die Produktion nach China verlegt, weil dort die Mindestlöhne noch billiger sind. Angeblich werden bis zu 40 Mio. Stück pro Jahr von diesem Ball verkauft.
Ich habe vor Kurzem Richard Schuberth, der ja auch bei euch schreibt, gefragt, wer die WM gewinnen wird. Er hat geantwortet: „Die Fifa.“
Ich habe auf einer gesellschaftskritischen US-amerikanischen Website eine Analyse gelesen, wie sich die Fußball-WM in vielerlei Hinsicht schädlich auf die gesellschaftlichen Zustände in Südafrika auswirkt. Das wird aber durch die Euphorie momentan total verdeckt. Das Land ist in keiner Weise in der Lage, die Betriebskosten der riesigen Stadien zu zahlen, und es gibt keine Konzepte über die zukünftige Nutzung dieser Stadien. Vor allem aber ist Südafrika in der Vorbereitung auf diese WM zu einem Polizeistaat geworden; die Sicherheitsgesetze wurden radikal verschärft, und es besteht Grund zur Annahme, dass diese nach der WM nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Aber es wird von positiven wirtschaftlichen Impulsen gesprochen.
Es wird behauptet, dass durch die Ausrichtung der WM viele Arbeitsplätze entstanden seien. In Wirklichkeit sind aber auch sehr viele zerstört worden, denn die Fifa hat den öffentlichen Raum rund um die Stadien völlig okkupiert. Es dürfen dort nur Produkte von Unternehmen, die WM-Sponsoren sind, verkauft werden; das heißt aber, dass Tausende von Straßenhändlern ihre Arbeit verlieren, weil sie sich die Fifa-Lizenz nicht leisten und somit nichts mehr verkaufen können.
Damit noch mal zur Schere zwischen Arm und Reich: Wie viel Ungleichheit verträgt das kapitalistische System?
Das wird sich weisen, denn die Bedingungen werden jetzt weiter verschärft. Die, die weniger haben, wollen am Überfluss der Reichen teilhaben; ohnehin nicht auf gleicher Augenhöhe, aber zumindest so, dass sie ein faires Leben führen können. Die Vorgangsweise bei der Bankenrettung und die Art, wie die Finanzen saniert werden, bringen aber jetzt einen weiteren Armutsschub. Die Regierungen wälzen das, was sie den Banken gegeben haben, auf die Bevölkerung um und lassen sie die Rechnung begleichen. Den Gesellschaften werden irrsinnige Sparprogramme oktroyiert, und dadurch werden die Leute noch ärmer.
Das ist ja eine internationale Entwicklung im Geiste des Neoliberalismus, die der einfachen Bevölkerung nichts bringt, aber die reichen Schichten begünstigt.
Ja, so ist es, und jetzt kommt es darauf an, wie sich die Menschen dagegen wehren. Zum Beispiel gibt es in Griechenland Generalstreiks, die ich persönlich als so etwas wie Zeremonien ansehe. Die griechische Gewerkschaftsbewegung ist geprägt von linken Parteien, die meiner Meinung nach sehr etatistisch sind, indem sie Forderungen an den Staat richten. Die Frage ist, ob man auf diesem Weg die Krise abwehren kann. Ich denke, es wäre wichtig, neben dem Staat und neben dem Markt Modelle von alternativem Wirtschaften zu entwickeln, bei denen man sich überhaupt nicht erst in Abhängigkeiten von Staat und Banken begibt, so wie das die Argentinier ganz gut gemacht haben.
Das habe ich jetzt nicht parat. Was war in Argentinien?
Eine Krise, wie sie jetzt in Griechenland herrscht, hatten die Argentinier schon vor zehn Jahren. Doch die haben eine Kultur der Selbstorganisation, die die Griechen offenbar nicht haben. In Argentinien wurden damals Hunderte von Betrieben besetzt; heute sind immer noch 200 davon genossenschaftlich in der Hand der Arbeiter organisiert. Eine solche Kultur der Selbstorganisation und die Bereitschaft, die Angelegenheiten in die eigene Hand zu nehmen, also Genossenschaften zu bilden, sind in Europa weitestgehend unbekannt. In Griechenland war zwar eine halbe Mio. Menschen auf der Straße und forderte vom Staat dieses und jenes, aber es tut sich dann nichts.
Kommen wir zu eurem Projekt Augustin, das als Obdachlosen-Zeitung gestartet wurde und sich auch mit Themen, die Minderheiten und soziale Ungerechtigkeit generell betreffen, beschäftigt.
Der Begriff mit den Obdachlosen bezieht sich mehr auf die Verkäufer. Wir haben nie von einer Obdachlosen-Zeitung gesprochen, das war nie unsere Selbstdefinition, wir sind nur von außen so etikettiert worden. Wir haben von Anfang an den Zugang zu unserem Vertrieb niederschwellig gehalten; das heißt, jeder, der glaubt, dass er Gründe hat, den Augustin zu verkaufen, kann kommen. Also jeder arme Schlucker kann sich mit dem Augustin was dazuverdienen. Der Status spielt für uns keine Rolle – ob jemand obdachlos oder arbeitslos, Junkie, Alkoholiker oder Haftentlassener ist. Diejenigen, die zu uns kommen, haben dafür einen Grund, weil sich niemand freiwillig stundenlang auf die Straße stellt.
Welches Spektrum deckt ihr thematisch ab?
Von den Themen und Inhalten her haben wir uns entschlossen, kein allgemeines politisches Magazin zu werden, das sämtliche Themen wie Parlamentarismus oder Parteipolitik oder Umweltpolitik behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf sozialen Themen, andererseits aber auch auf Kunst und Kultur. Wobei wir vor allem künstlerische Initiativen und Menschen porträtieren, die am Rand des Kunstbetriebs angesiedelt sind.
Und ihr seid über die Jahre zu einer richtigen Qualitätszeitung geworden, die man nicht aus Mitleid kauft, sondern weil sie eine interessante Zeitung ist.
Das freut mich, dass du das so siehst; es gibt aber auch viele, die uns vorhalten, dass wir viele Regeln des Qualitätsjournalismus verletzen. Vor allem, weil wir bewusst sehr parteiisch sind. Es gibt bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die sich nicht sehr gut artikulieren können, und die werden bei uns privilegiert behandelt. Die bekommen bei uns eine Plattform und eine Ausdrucksmöglichkeit, die sie sonst nicht haben. Und dafür verzichten wir auch auf den im Qualitätsjournalismus sonst geforderten Objektivismus. Das heißt, nicht jede Kritik, die von unten kommt, wird immer durch die Darstellung der Kritisierten gespiegelt. Wir lassen einfach die Position oder die Kritik der Leute von unten zu, ohne dass wir diese mit einer Gegenmeinung konfrontieren. Das ist unsere Parteilichkeit, die den üblichen journalistischen Regeln widerspricht.
Stellt sich die Frage, wo in anderen sogenannten gehobenen Blättern die Objektivierung zu finden ist, denn gerade dort bekommen die von dir angesprochenen Leute diese Stimme nicht.
Es wird eh zum Teil geschätzt, für andere gelten wir aber nicht als Teil der journalistischen Landschaft und werden auch kaum zitiert. Ich glaube, dass uns die Journalisten – auch die der großen Medien – sehr genau lesen, immer wieder auch von uns etwas entnehmen, wir sind aber nicht zitabel. Wir sind als Medium nicht anerkannt wie etwa mittlerweile der Falter, der auch im ORF zitiert wird.
Der Falter ist aber gegenüber seinen Anfängen auch schon ziemlich handzahm geworden.
Ja, das sehe ich auch so, er hat nicht mehr diesen Stachel wie früher. Wir unterscheiden uns auch dadurch, dass wir keinen Wert auf die Trennung von Nachricht und Meinung legen, wie es der Schuljournalismus fordert. Wir kümmern uns um solche journalistischen Gesetze überhaupt nicht. Egal welche Nachrichten ich bringe, ich schreibe auch immer ohne Genierer meinen Kommentar dazu.
Man kann allerdings diesen sogenannten objektiven Zugang über die Kommunikationstheorie ziemlich auf die Schaufel nehmen. Es werden ja auch die anderen Medien durch Auswahl der Themen, Wortwahl, Weglassungen, Bildbotschaften et cetera gemacht, da steckt doch immer und überall viel Haltung und subjektive Position drinnen, sodass das über diese formalen Elemente genauso meinungs- und kommentarlastig ist.
Kann man so sagen.
Wo kriegt ihr aber dann immer die guten Autoren her, wenn ihr nicht die marktgängige Reputation habt?
Immerhin gibt es uns schon seit 15 Jahren, und die Leute kommen immer mehr drauf, dass der Augustin eine Publikationsmöglichkeit für anspruchsvolle Texte ist; die auch lang sein dürfen, denn wir folgen nicht dem modernen Marktgesetz, das kurze Texte und möglichst viele Bilder fordert. Bei uns kann man noch ausführliche zweiseitige Texte lesen. Und es gibt für kritische Journalisten eben wenige Publikationsmöglichkeiten. Außerdem zahlen wir kollektivvertragskonforme Honorare, und die prompt, was für freie kritische Journalisten durchaus attraktiv ist. Wir haben heute ein Netzwerk von freien Journalisten und Experten für Sozialarbeit, das aus 70 bis 80 Leuten besteht, die mehr oder weniger regelmäßig Beiträge liefern. Und zwar so intensiv, dass wir damit auch eine Wochenzeitung füllen könnten, aber das schaffen wir finanziell nicht.
Und wie sieht es mit eurer Unabhängigkeit aus, wo ihr doch auch Inserate in der Zeitung habt?
Wir nehmen Inserate, aber keine Subventionen. Und Inserate nehmen wir auch nicht von jedem. Was wir aber strikt ablehnen, ist die Vermischung von Inseratauftrag und damit verbundenem redaktionellem Gefälligkeitsjournalismus. Beim Augustin kann man sich keinen Artikel kaufen. Subventionen nehmen wir weder vom Land noch vom AMS, weil wir auf drei Gebieten völlig unabhängig bleiben wollen. Erstens auf dem Gebiet der sozialen Arbeit, zweitens auf dem Gebiet unserer eigenen Organisationsstruktur und drittens in unserem parteilichen Journalismus für die Menschen von unten, über den wir ja schon gesprochen haben.
Diesen Teil des Projekts haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Was verstehst du unter Unabhängigkeit in der Sozialarbeit?
Weil wir im Unterschied zu den meisten Sozialeinrichtungen von den Leuten nichts verlangen. Wir haben nicht die Orientierung, dass sie in den regulären Arbeitsmarkt eingegliedert werden müssen. Würden wir vom AMS Geld erhalten, müssten wir uns verpflichten, dass wir pro Jahr soundso viele Verkäufer in den regulären Arbeitsmarkt integrieren. Und diesen Zwang wollen wir den Leuten nicht antun. Wir wissen, dass der Arbeitsmarkt derzeit sowieso die fittesten Leute freisetzt, und unsere Leute sind aus den verschiedensten Gründen nicht in der Lage, diese Tempogesellschaft mitzumachen.
Aus welchen Gründen zum Beispiel?
Da gibt es alle möglichen psychiatrischen Diagnosen; das sind vielfach Leute, die einfach nicht können. Und von uns gibt es für diese Menschen überhaupt keinen Druck, sich einzugliedern; andererseits können sie beim Augustin bleiben, solange sie wollen. Wir nehmen sie so, wie sie sind. Dabei erleben wir aber auch viele Integrationserfolge; viele Leute stabilisieren sich durch den Augustin, entweder durch das Verkaufen oder durch die Teilnahme an verschiedenen Projekten, die wir anbieten: etwa am Fußballprojekt „Schwarz-Weiß Augustin“ oder am Chorprojekt „Stimmgewitter“. Da gibt es viele individuelle Erfolge; aber nie zwangsweise, das kommt praktisch von selber. Dieser Zwang, die Leute zu integrieren, fällt bei uns völlig weg.
Kann man sagen, dass ihr den Leuten ihren Selbstwert wieder zurückgebt?
Die Leute wissen, dass sie mit ihrer Präsenz auf der Straße und in den Projekten lebenswichtig für das gesamte Projekt Augustin sind, dass wir auch von ihnen abhängig sind. Es gibt nicht dieses vormundschaftliche Verhältnis zwischen Sozialarbeitern und Klienten; das kannst du hautnah in unserem Vertriebsbüro erleben. Das heißt aber natürlich nicht, dass unsere Sozialarbeiter nicht helfen, wenn es Probleme gibt, nur fällt bei uns dieser Integrationsdruck weg.
Als weiteren Punkt hast du noch eure Organisationsstruktur genannt.
Wir sind als Verein organisiert und haben 13 Angestellte. In diesem Verein gibt es aber keine Hierarchie, keine Arbeitsteilung. Alle Entscheidungen, die wir im Augustin treffen, müssen Konsensentscheidungen sein. Die Journalisten müssen auch bei Fragestellungen, die zur Sozialarbeit gehören, mitdiskutieren, und umgekehrt die Sozialarbeiter bei redaktionellen Fragestellungen. Die Entscheidungen fallen dann im Plenum.
Und das funktioniert?
Das ist ein basisdemokratisches Experiment. Viele Leute sind verwundert, dass das funktioniert, einen Betrieb ohne Chef so kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Wir bekommen auch viele Einflüsterungen von Organisationsentwicklern, die sagen, dass das völlig uneffektiv sei. Wir müssten den Vertrieb vom Zeitungsmachen trennen, es müsste ein Gremium für den Vertrieb und eines für die Medien geben, denn wir produzieren ja auch noch Radio- und Filmbeiträge. Wenn es diese Gremien aber gäbe, bräuchten wir eine Koordinationsstelle darüber – und das wäre dann schon der Beginn einer Hierarchie. Wir wollen uns aber dieses Konsensprinzip, diese Cheflosigkeit und diese Basisdemokratie unbedingt erhalten.
Economy Ausgabe 85-06-2010, 25.06.2010
 Loebell
Loebell