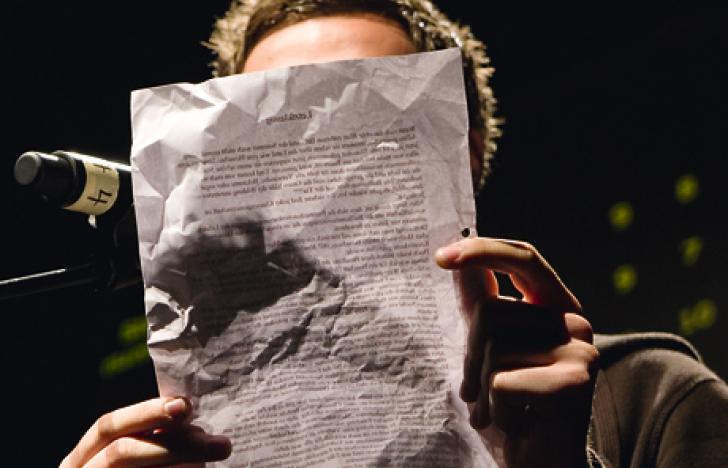Sex, Liebe und Rock ’n’ Roll
 APA/Herbert Oczeret
APA/Herbert OczeretKunst ist Berufung und Zufall und Wagnis und Befreiung. Patti Smith dichtete, und Robert Mapplethorpe malte, als sie jung waren und sich liebten. Er suchte Sex mit Männern und wurde ein begnadeter Fotograf, sie Rocksängerin.
Er brauchte Fotos von nackten Männerkörpern für seine Collagen. Doch die Pornomagazine waren in Zellophan eingeschweißt, man durfte die Folie vor dem Kauf nicht aufreißen. So riskierte er jedes Mal, dass er sein Geld umsonst für ein Schwulenheft rausschmiss und nichts davon verwenden konnte – und dabei hatte er so wenig Geld.
Seine Freundin Patti sagte ihm oft, er solle doch selber fotografieren. Doch er glaubte, er wäre zu ungeduldig, er wollte nicht stundenlang in der Dunkelkammer stehen. Als er einmal bei einer Freundin eine Polaroidkamera herumliegen sah, griff er Pattis Anregung auf und borgte sich die Kamera aus. Aber die Kosten für einen Polaroidfilm waren hoch, zehn Fotos für drei Dollar, das war 1971 viel Geld. Also legte er die Kamera wieder beiseite. Einstweilen.
Kunst ist Berufung
Kunst ist auch Zufall. Bevor Robert Mapplethorpe zu einem begnadeten und skandalträchtigen Fotografen wurde, zeichnete und malte er jahrelang, machte Collagen und kunstvolle Halsketten aus Materialien, die er fand oder billig kaufte: aus Federn, aus Perlen, aus allem Möglichen. Sogar aus Hummerresten, die in Restaurants auf leer gegessenen Tellern lagen. Patti packte die Hummerscheren in eine Serviette, bevor die Teller abgeräumt wurden, Robert schrubbte sie, besprühte sie mit Farbe und fädelte sie mit anderen Fundstücken zu Halsbändern auf. Verkauft hat er von seinen frühen Werken kaum etwas.
Patti sorgte in diesen Jahren, von Herbst 1967 bis in die frühen 1970er Jahre, zu einem großen Teil für ihren gemeinsamen Lebensunterhalt: Sie arbeitete ganztags in einer Buchhandlung und später in einem Verlag. Abends arbeiteten sie gemeinsam im Atelier. Sie schrieb Gedichte, und sie zeichnete.
Kunst ist Sehnsucht
Mit zwölf beschloss Patti, Künstlerin zu werden. Damals hatten ihre Eltern Geld zusammengekratzt, um mit den vier Kindern mit dem Bus nach Philadelphia zu fahren und ins Kunstmuseum zu gehen. Modigliani und Picasso zu sehen hat das Kind transformiert. „Ich hatte keinerlei Indiz, dass ich das Zeug zur Künstlerin hatte, obwohl ich danach hungerte, eine zu sein“, schreibt die Poetin und Rocksängerin Patti Smith in ihrem kürzlich erschienenen Buch Just Kids. Darin geht es um Selbstfindung und Selbstwerdung: um ihre eigene und die von Robert Mapplethorpe, ihrem Geliebten und später Freund in alle Ewigkeit.
19-jährig gebar Patti Smith ein Kind, gab es zur Adoption frei und schwor ihrem nie gesehenen Kind und Jeanne d’Arc, ihrer geheimen Heldin, dass sie aus ihrem Leben etwas machen würde: Sie verließ das ländliche South Jersey, fuhr mit wenig Geld nach New York City und suchte Arbeit. Sie wollte Künstlerin werden, wusste aber, dass sie sich eine Kunstakademie nicht leisten konnte. Sie las Charles Baudelaire und Arthur Rimbaud – ihre Verwandten im Geiste.
Kaum in New York angelangt, lernte Patti Robert kennen. Nach ihrer ersten Nacht war unausgesprochen klar, dass sie zusammenbleiben würden. Sie waren arm. Manchmal blieben sie hungrig, wenn sie für Essen kein Geld hatten, oder sie teilten sich ein Sandwich. Auch Museumsbesuche „teilten“ sie: Eine/r ging ins Museum, absorbierte das Gesehene und erzählte dem/der anderen draußen Wartenden davon. „Eines Tages werden wir beide reingehen, und die Kunst ist dann unsere eigene“, sagte Robert einmal, nachdem er vor dem Whitney Museum auf Pattis Schilderung gewartet hatte. Er war sich sicher, dass er den Durchbruch schaffen würde. Er war überzeugt vom Wert seiner Arbeit.
Kunst ist Ehrgeiz
Doch bevor Robert den künstlerischen Durchbruch schaffte, brach etwas anderes aus ihm heraus: seine sexuelle Neigung zu Männern. Er hatte Affären mit Männern, er hatte Liebesbeziehungen, und manchmal war er Stricher – um Geld zu beschaffen, und auch aus Lust.
Robert und Patti trennten sich manchmal räumlich wegen eines Liebhabers (von ihr oder von ihm), doch sie liebten sich und blieben aufeinander bezogen. Als sie einmal von einer Reise nach Paris zurückgekehrt war und ihn schwerkrank vorfand, versprachen sie einander, dass sie sich nie wieder allein lassen würden, solange sie nicht sicher waren, dass beide auf eigenen Beinen stehen konnten. „Und diesen Schwur haben wir gehalten, trotz allem, was uns noch erwartete.“
Im Chelsea Hotel, einem legendären Wohnort von Künstlern, fanden sie ein Refugium. Von dort aus eroberten sie die Kunstszene. Bei Patti verlief vieles nach Zufall, Robert ging systematisch vor. Er war ehrgeizig. Er wollte in die Kreise von Andy Warhol vordringen. Auf dem Weg dorthin lag Max’s Kansas City, ein Lokal, in dem der Warhol-Hofstaat die Nächte verbrachte. Pech nur, dass Warhol nicht mehr oft ausging, seit er 1968 angeschossen wurde und fast gestorben war. Glück aber, dass Mapplethorpe begehrt wurde. Alle waren hinter ihm her, Männer wie Frauen, aber Roberts Triebfeder war damals sein Ehrgeiz, nicht Sex. „Sie hatten es auf ihn abgesehen, so wie er es auf den Inner Circle abgesehen hatte“, schreibt Smith.
Kunst braucht Kapital
Ein Museumskurator, der in (unerfüllter) Liebe zu Mapplethorpe entbrannte, verschaffte ihm Zugang zu den Reichen, nahm ihn mit auf Reisen nach Paris, wo sie mit Yves Saint Laurent und seinem Partner Champagner tranken, kaufte ihm eine Kamera und arrangierte einen Vertrag mit Polaroid über kostenlose Filme. Kurze Zeit später lernte Mapplethorpe Sam Wagstaff kennen, seinen Mäzen, Geliebten und Freund bis ans Lebensende. Wagstaff war reich und einflussreich. Er kaufte Mapplethorpe eine Hasselblad und ein Atelier. Mapplethorpe konzentrierte sich nun ganz auf die Fotografie. Künstler war er bereits, fotografieren hatte er mit der Polaroid gelernt, bevor er Wagstaff traf. Doch ohne die finanziellen Ressourcen seines Liebhaber-Mäzens, ohne dessen Zugang zur High Society der Kunst wäre Mapplethorpe nicht der geworden, der er wurde.
Patti Smith hatte immer geschrieben, inspiriert von Rimbaud und ihren lebenden Dichterfreunden Allen Ginsberg und William Burroughs. Doch sie war wohl weniger von ihren Fähigkeiten überzeugt als Mapplethorpe von seinen –
und ihren. Er war es, der sie anstachelte, mehr zu schreiben, mehr zu zeichnen. Er sagte ihr, dass er ihre Stimme liebte. Es war nie ihr Traum gewesen, Musikerin zu werden. Im Chelsea lernte sie zwar die Größen der Zeit kennen, Jimi Hendrix und Janis Joplin. Doch eine Rocksängerin, eine Poetin auf der Bühne wurde sie erst, als Robert und andere Freunde sie drängten, ihre Gedichte öffentlich vorzutragen. Sie wollte etwas Machtvolles daraus machen, eine Beat-Performance. So bat sie einen befreundeten Musiker, mit seiner E-Gitarre einen Autocrash zu spielen. Vier Jahre später nahm sie ihre erste LP Horses auf. Das Coverfoto, Patti im weißen Hemd mit schwarzem, über die Schulter geworfenem Sakko machte beide bekannt: Sängerin und Fotograf.
Kunst ist Wagnis
Kunst ist Tod, ist man versucht zu sagen, angesichts der Musiker, die früh wegen Drogen zu Tode gekommen sind, und der Künstler, die die Krankheit Aids hinweggerafft hat – wie Mapplethorpe, der 1989 starb. Doch an Drogen, Unfällen und Aids sterben Künstler und Nichtkünstler gleichermaßen.
Es ist eher die Nähe zum Risiko. Kunst ist Wagnis, ist Grenzüberschreitung. Das ist der Bereich, mit dem Mapplethorpe zum kontroversen und Skandale produzierenden Fotografen aufstieg. Es waren nicht seine perfekt in Szene gesetzten Lilien und Tulpen, die ihn berühmt machten. Sondern seine Aufnahmen in der homosexuellen Sadomasoszene in New York.
Patti Smith ist kein Superstar geworden. Eher eine Ikone. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zog sie sich zurück, lebte mit ihrem Mann und zog ihre zwei Kinder groß. Erst nach persönlichen Tragödien, nach dem Tod ihres Mannes, kam sie auf die Bühne zurück.
Buchtipp
Patti Smith: „Just Kids. Die Geschichte einer Freundschaft“, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2010, 20,60 Euro, ISBN: 978-3462042283
Economy Ausgabe 84-05-2010, 28.05.2010
 Reiffeisen Informatik
Reiffeisen Informatik