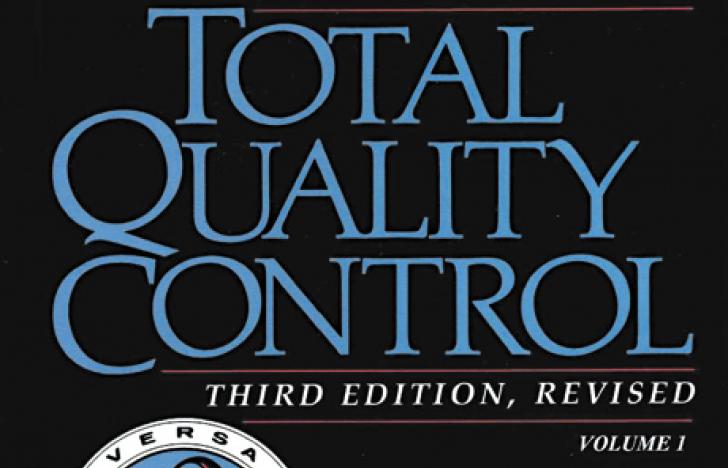Große Klasse
 Photos.com
Photos.comUmfassendes Qualitätsmanagement.
Die Produkte werden – vermeintlich – immer besser, die Anforderungen an Waren und Dienstleistungen immer komplexer. Und die Kunden werden immer wählerischer. Wer künftig in der Liga der Besten mitspielen will, braucht ein neues Verständnis von Exzellenz.
Zuverlässigkeit als alleiniges Qualitätsmerkmal reicht heute nicht aus. Der Kunde erwartet nahezu perfekte, effizient und kostengünstig hergestellte Produkte. In die Kaufentscheidung fließen weiters Funktionalität, Design, also Optik, Haptik und Verarbeitung, aber auch Service, Marke und Image des Unternehmens ein. Experten nennen das „kreative Qualität“. Qualität beinhaltet künftig also zweierlei: die Gesamtstimmigkeit eines Produktes zum angemessenen Preis und eine fehlerfreie Funktionserfüllung über die Zeit, also Zuverlässigkeit. Vor dem Hintergrund der von ihm selbst akribisch praktizierten und weltweit kopierten Lean-Production-Philosophie mit dem Fokus auf einer fehlerfreien Produktion gewinnen die aktuellen Probleme von Toyota, einem Unternehmen, das branchenweit in puncto Qualität Maßstäbe setzte, besondere Brisanz.
In der modernen Qualitätswelt könnten europäische Unternehmen punkten. Gruppenkonformität, Harmoniestreben und Nullfehlermentalität, wie man sie in Asien oft beobachtet, befördern eher die Qualitätsdimension Zuverlässigkeit als die kreative Qualität. In Europa hingegen sind Problemlösungskompetenz, Unternehmergeist, Risikobereitschaft und Fantasie stark ausgeprägt. Das birgt Chancen, sich weltweit neu zu positionieren, als kreative Qualitätsführer mit verlässlicher Tradition.
Höchstmöglicher Service
Während sich ein fehlerhaftes Produkt noch in der Fabrik aussortieren oder reparieren lässt, erlebt der Kunde die Qualität einer Dienstleistung unmittelbar. Dienstleistungsqualität erfordert deshalb präventives Qualitätsmanagement. Das Ziel muss höchstmöglicher Service sein. Dies beginnt bei der Entwicklung von Dienstleistungen und endet beim Kundendienst. Tests und Simulationen sind nur der erste Schritt zur Qualitätssicherung. Qualität muss in das Produkt integriert sein, das verlangt schon die Zahl der Beteiligten. So wirken etwa an der Entwicklung eines Autos mehr als 2500 Menschen mit. Qualität kann da nicht mehr Einzelaufgabe sein, sondern muss als Querschnittsaufgabe begriffen und gemanagt werden.
Kunden vergleichen gnadenlos, das beste Qualitäts-Preis-Verhältnis gewinnt. Entspricht die Qualität nicht seinen Erwartungen, kommt der Kunde nicht wieder und berichtet im Schnitt zwölfmal von seinem negativen Erlebnis. Ist er begeistert, erzählt er nur dreimal davon. Ein Grund mehr, das Thema Qualität und dessen permanente Verbesserung ernst zu nehmen.