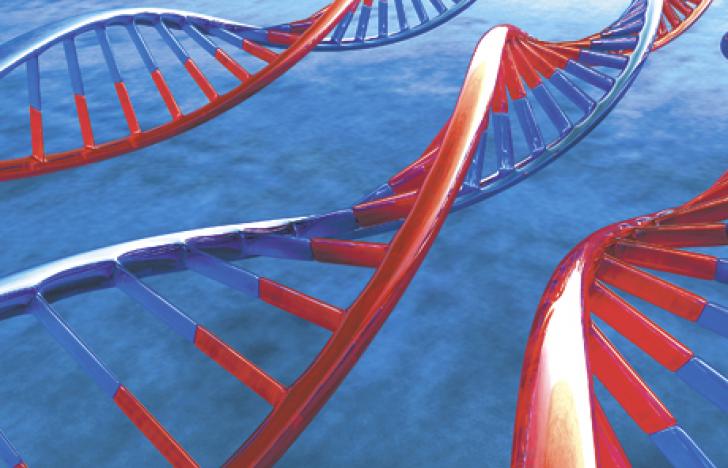Das zweite Hemd
 Photos.com
Photos.comVon Altkleidern über Schrottautos, Elektronikmüll bis hin zu abgelaufenen Medikamenten: Die Dritte Welt, insbesondere Afrika, liegt am Ende der Konsumkette. Und der reiche Westen verdient auch noch dran.
In Afrika gibt es im Wesentlichen zwei Sorten von Moden: Die eine ist die traditionelle, meist farbenprächtige Kleidung, die alle möglichen Erscheinungsformen hat, seien es gefärbte Wickeltücher wie Kitenge oder Kanga, Kaftans in vielfältiger Ausprägung je nach kulturellem Einfluss und Erbe, und elegante weiße Stoffroben für feierliche Anlässe.
Die zweite Modeerscheinung in Afrika ist Mitumba, etwas zynisch auch als „Hemd des toten weißen Mannes“ bezeichnet. Es handelt sich dabei um Kleider aller Art, die per Altstoffsammlung den Weg auf den Schwarzen Kontinent gefunden haben. Mitumba ist ein großer Industriezweig geworden, seitdem es karitative und kommerzielle Organisationen aus der Ersten Welt verstanden haben, die Altkleidersammlung nicht nur kostendeckend zu gestalten, sondern auch kräftig Gewinn daraus zu schlagen.
Der in Dubai ansässige Erdöltechniker Richard Hirons berichtet von seinem letzten Nigeriaauftrag. In Port Harcourt, dem geschäftigen Ölzentrum im Süden des Landes, gibt es einen großen Okrika-Markt (Okrika ist das westafrikanische Äquivalent zu Matumba). „Die Leute wissen, dass die Klamotten allesamt Second-Hand-Ware aus Europa und Amerika sind, aber erstaunlicherweise – und trotz der Bannversuche der Regierung, die um die einheimische Textilindustrie fürchtet – ist der Markt der belebteste.“
Junge Nigerianer beweisen, dass der Konsumentenappetit auf das „Hemd des toten weißen Mannes“ groß ist. Man sieht Jugendliche mit T-Shirt herumlaufen, auf denen die Markenlogos westlicher Konzerne, Banken und Vereine zu lesen sind. Was hier als ungewünschter Werbeartikel zum Müll wandert oder als Küchenfetzen benutzt wird, trägt der junge Nigerianer mit Hingabe, etwa das knallgelbe „Postbank“-T-Shirt in Kombination mit der zu weiten ausgeleierten Gabardine-Hose, die schon bessere Zeiten gesehen hat.
100 Euro für eine Tonne
Mitumba-Märkte sind meistens die letzte Station in der Wertschöpfungskette von Altkleidern, die man zum Beispiel in den Humana-Container im Beserlpark in Wien einwirft. Von dort werden die Kleider gesammelt, tonnenweise verpackt und verschifft – nach Mozambique, Angola, Nigeria und an andere große Cargo-Häfen an Afrikas Küste.
Wurde die Ware früher noch in Europa sortiert und gereinigt, wird dies heute größtenteils von Subunternehmern übernommen, die auf dem Weg liegen: In Nordafrika oder in Dubai. In Afrika werden die Container von ansässigen Handelsunternehmen in Empfang genommen und in den kommerziellen Kreislauf gebracht.
Diese Verschiffung von Altkleidern wird seit etwa zehn Jahren betrieben, und natürlich hat sich seitdem ein Marktpreis für die Ware gebildet. Für eine Tonne unsortierter Altkleider wird von Händlern derzeit zwischen 100 und 150 Euro bezahlt, für eine Tonne gebrauchte Schuhe gibt es bis zum Dreifachen des Altkleiderwertes. Da zuletzt die Spendierfreudigkeit der Europäer im Zuge der Finanzkrise etwas abgenommen hat, sind die Preise zuletzt wieder ein klein wenig gestiegen.
„Als der Import von gebrauchter Kleidung vor etwa zehn Jahren im wirklich großen Stil anlief, hatte das verheerende Auswirkungen auf die afrikanische Textilindustrie, zahlreiche Fabriken haben seither geschlossen“, kritisiert Neil Kearney von der internationalen Textilarbeitergewerkschaft ITGLWF. Die Import-Ramschware, von der die „karitativen“ Organisationen profitieren, würden die Bemühungen der afrikanischen Staaten, eine eigene Textilindustrie aufzubauen, wieder zunichtemachen.
Stimmt nicht, kontern die Vertreter von Humana und Co. Der Altkleiderhandel in Afrika gebe vielen Menschen Arbeit und vermittle wirtschaftliches Know-how. Außerdem würde der Markt sonst eben von billiger Ware aus China überflutet, denn die Eigenproduktionen von Textilien in Afrika seien in den seltensten Fällen gegenüber der großindustriellen Produktion preis- und qualitätsmäßig konkurrenzfähig.
Wie auch immer, Tatsache ist, dass man sich angesichts dieses kommerziellen Kreislaufs durchaus fragt, wo denn der karitative Zweck des Ganzen abgeblieben ist. Ein gebrauchtes Gucci-T-Shirt mit Glitzerkristallen („Made in Italy“) ist auf einem der zahlreichen Matumba-Märkte in Dar-Es-Salaam ab ungerechnet einen Dollar zu haben, wie der Autor dieser Zeilen im September feststellen konnte. Allerdings auch nur, wenn man sich in einheimischer Begleitung befindet. Für Touristen oder generell allein reisende Weiße werden unverschämte zehn Dollar für das nicht einmal gewaschene, höchstens gelüftete Textil veranschlagt. Okay, das Original im Gucci-Laden daheim kostet 70 Euro.
Ein noch weitaus sensibleres Problem ist der florierende Export von Elektronikschrott in die Dritte Welt, ebenfalls überwiegend nach Afrika. Das beginnt bei elektronischen Bau- und Ersatzteilen und endet bei gebrauchten Computern und Handys. Schwarze Schafe in der europäischen Industrie haben eine Marktlücke erkannt und deklarieren tatsächlichen Elektronikschrott häufig als Second-Hand-Ware, um sie sodann nach Afrika zu liefern. Dort werden die Elektronikteile in einfachen Workshops in der Nähe der großen Häfen ausgeschlachtet oder repariert, wobei den dortigen Arbeitern nicht bewusst ist, dass sie meistens auch mit giftigen Chemikalien zu tun haben. Vieles wird dann auch auf Müllhalden offen endgelagert und bleibt ein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung.
Einfuhrstopp für Elektronik
Uganda hat aus diesem Grund im Oktober 2009 einen Einfuhrstopp für Gebrauchtcomputer verhängt, auch wenn diese aus noch so karitativen Absichten dorthin versandt wurden. Neben verschärften Kontrollen setzt auch Europa auf strengere Gesetze. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die veraltete Elektroschrottrichtlinie zu überarbeiten. Sie soll die Mitgliedsländer dazu verpflichten, weitaus mehr Elektrogeräte zu recyceln. Außerdem soll der illegale Handel dadurch eingeschränkt werden, dass gebrauchte Geräte vor ihrem Export zertifiziert werden müssen. So sollen keine Schrottprodukte mehr in Entwicklungsländern landen.
Die ganze Action erfolgte erst, nachdem Greenpeace im vergangenen Jahr heimlich den Weg eines defekten Fernsehers von England nach Nigeria mithilfe eines versteckten GPS-Senders verfolgt hatte. Das Gerät, das beim Zerlegen Quecksilber, Blei und Cadmium freisetzt, hätte nicht dorthin exportiert werden dürfen.
Letztes Jahr hat Greenpeace in der Studie Poisoning the Poor gezeigt, dass europäischer Elektronikschrott Deponien in Ghana vergiftet. „Greenpeace hatte in diesem Jahr zwei zugängliche Schrottplätze in Ghana untersucht, einen davon in der Hauptstadt Accra. Wie sich herausstellte, wahre Giftmülldeponien. Erd- und Sedimentsproben ergaben eine teuflische Mischung aus Blei, Kadmium, chlorierten Dioxinen und anderen hochgiftigen Chemikalien. Ähnliche Giftmischungen hatte Greenpeace bereits zuvor auf Plätzen in China und Indien nachgewiesen“, so Simone Wiepking von Greenpeace Deutschland.
Afrika ist aber bei Weitem nicht die einzige Gegend, diemit diesen Problemen klarkommen muss. Als der Autor letztes Jahr im Zuge einer monetären Ebbephase alte Elektroniksachen wie Schaltgeräte, Uralt-Lautsprecherboxen und Verlängerungskabel beim Second-Hand-Händler in Wien-Gumpendorf verscherbelte und verwundert wissen wollte, ob sich dafür je Käufer finden werden, fiel die lakonische Antwort: „Das Zeug schicken wir sowieso zum Kilopreis nach Kuba.“
Unendliche Kette
Na gut, wenigstens hat mich die Aussicht besänftigt, dass ein begnadeter kubanischer Bastler die 20 Jahre alten Philips-Lautsprecher wieder zum Leben erweckt und aus ihnen fortan liebliche Rumba-Rhythmen durch Havannas Gassen tönen. Dennoch: Der Weg unserer Konsumgüter ist sonderbar, und die Wertschöpfungskette offenbar unendlich.
Ein anderes Thema ist der rege Handel mit Second-Hand-Autos (oder besser Altautos) mit der Dritten Welt. Für Ostafrika und Mittelasien ist Dubai der größte Umschlagplatz, und bekannt dafür sind die zahlreich abgehaltenen Autoschnellauktionen. Auf diesen werden an mehreren Tagen pro Woche Autos jeder Qualität zur Versteigerung angeboten und die allermeisten Vehikel auch in Minutenschnelle an den Mann gebracht.
Mohammad Majid, ein Autohändler aus dem Sudan, ist regelmäßiger Gast auf den Dubai-Auktionen. Er deckt sich dort mit Fahrzeugen aller Art ein, für die auch nur die geringste Aussicht auf Profit besteht, wenn Auktionskosten, Verschiffung, Zoll und seine Provision abgedeckt sind. Den Weg, den die Autos nehmen, verläuft von Dubais Hafen Jebel Ali nach Djibouti, von wo aus die Autos dann über ganz Ostafrika weiterverteilt werden.
Um die technischen Gebrechen kümmert sich Mohammad dabei wenig: „Das wird von unseren Mechanikern in Karthum schon in Ordnung gebracht.“ So steigert er auf einen 15 Jahre alten Nissan, dem die Kotflügel traurig herabhängen und in dessen Fahrertür ein faustgroßes Rostloch prangt. Der Öamtc würde sich mit Grausen abwenden. Mohammad schreibt den Wagen zum Auktionspreis von 2000 Dirham (390 Euro) zufrieden auf seine Liste.
Die Verschiffung von Altautos in arabische Länder oder nach Afrika hat übrigens auch für zahlreiche Betrugsfälle bei der Abwrackprämie gesorgt. Für nicht wenige Händler aus Europa war dies eine willkommene Möglichkeit, um die Wracks loszuwerden.
Irgendwann sterben aber auch alte Autos. Dann landen sie meistens auf illegalen Deponien irgendwo in der Wüste oder der afrikanischen Steppe, wo Altöl, Korrosion und verrottender Kunststoff die Umwelt belasten.
Eine Entsorgungslösung wird unter der Hand im Emirat Sharjah angeboten. Wer ein altes Auto hat, das mit ein paar Kunstgriffen zumindest noch einige Meter fahren kann, der kann es einem Mittelsmann zur Verschiffung in den Irak, Afghanistan oder Pakistan übergeben. Dort werden die Autos dann mit Sprengstoff zugepackt und als rollende Bomben verwendet. Das ist kein Witz.
Economy Ausgabe 78-11-2009, 20.11.2009