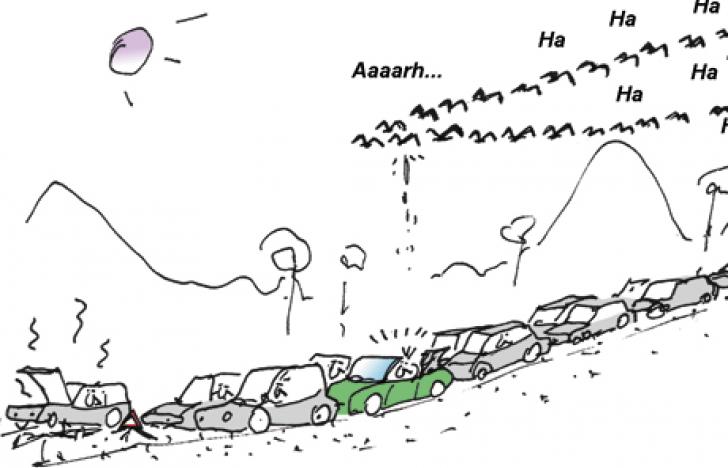Fahren im Jahr 2030
 Photos.com
Photos.comDie Telematik wird die Art und Weise, wie wir uns von A nach B bewegen, revolutionieren. Moderne Verkehrssteuerung verringert Stauzeiten und erhöht die Sicherheit, dafür beschneidet sie individuelle Freiheiten.
Ein Montagmorgen im Jahr 2030: Frau Müller wohnt auf dem Land und muss zu einem Weiterbildungsseminar in die Stadt. Sie ist spät dran. Sie spricht Zielort und gewünschte Ankunftszeit in ihr Handy, das zugleich Navigationssystem ist.
Das Navi berücksichtigt Pkw, Bahn, Rad, Bus, Carsharing und U-Bahn. Es berechnet den schnellsten Weg und achtet auf alle wichtigen Parameter: Wetter, Staumeldungen, Kostenvergleich Straße/Schiene, Mitfahrgelegenheiten in der Nähe und natürlich die Präferenzen von Frau Müller. Es schlägt vor, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, dort zu parken und dann auf die Tram umzusteigen. Frau Müller bestätigt die Tour und steigt ins Auto. Der Bordcomputer synchronisiert sich automatisch mit dem Navi.
Auf die Autobahn fährt Frau Müller zu schnell auf. Ihr Auto verringert die Geschwindigkeit zum Vordermann automatisch, das Fahrzeug kommuniziert mit den anderen Autos und hält den Idealabstand. Der ganze Autoschwarm wiederum wird von einem Antistausystem gesteuert. Die Geschwindigkeitskontrolle hilft Frau Müller, Strafen zu vermeiden, denn das ganze Land ist eine einzige Section Control. Jetzt passiert sie einen gefährlichen Abschnitt, wo sie gar nicht zu schnell fahren könnte, auch wenn sie wollte, denn die Elektronik im Auto würde das Auto auf das erlaubte Tempo reduzieren.
Frau Müller fährt einen alten SUV, der noch mit Benzin betrieben wird. Pro Kilometer zahlt sie daher den höchsten, nach Emissionen gestaffelten Tarif. Die City-Maut ist hoch; für einen ganzen Arbeitstag würde das Navi Frau Müller auf die U-Bahn umleiten, doch sie bleibt nur zwei Stunden in der Stadt und fährt direkt in ein Parkhaus, um hohe Kosten durch die Parkplatzsuche zu vermeiden.
Die Gebühr wird beim Verlassen der Stadt vom Handy abgebucht. Das Wetter hat gedreht, darum schlägt das Handy statt der Tram ein verfügbares City Bike für die letzte Wegstrecke vor. Frau Müller bestätigt; sie kann die Bewegung brauchen und löst mit dem Navi-Signal die Absperrung. Zurück zur Garage fährt sie wegen ein paar bedrohlicher Wolken mit der Tram. Das Ticket löst sie mit ihrer Mobility-Card beim Einsteigen automatisch. Das Guthaben für die M-Card hat sie davor aufgeladen. Mit der Karte, die in das Navi und Handy integriert ist, kann sie alle Kosten, die im Verkehr anfallen, von Maut über Metro bis City-Bike und Tanken, begleichen.
Zurück in die Gegenwart
Die hier skizzierten Telematiklösungen werden teils schon angewendet, teils befinden sie sich noch im Entwicklungsstadium. Technisch machbar sind sie alle. Dennoch könnte einiges aus politischer Sicht auch in Zukunft eine Utopie bleiben.
Vor etlichen Jahren hat Federal Highways in Washington D. C. ein Forschungsprojekt mit dem Namen Vehicle Infrastructure Integration (VII) initiiert. Dabei kommunizieren Fahrzeuge über ein WLAN (drahtloses Netzwerk) an der Straße mit der Infrastruktur und anderen Fahrzeugen. Ziel ist es, menschliches Risiko auszuschalten und durch den optimierten Abstand der Fahrzeuge zueinander die Straßen besser zu nutzen und Staus zu vermeiden. Nicht eine Zentrale lenkt den Verkehr, es bauen sich nach der Logik eines Bienenschwarms Ad-hoc-Netzwerke auf. Die Wahrscheinlichkeit für die Umsetzung dieses Projekts ist gering. Das Unternehmen Kapsch Traffic Com, das über seine Tochterfirma in San Diego am Projekt beteiligt sind, rechnet in den USA nicht vor 2030 damit. Die Autoindustrie wird sich wehren, die Elektronik standardmäßig einzubauen, also müsste der Staat die Geräte gratis zur Verfügung stellen, denn das System lebt von einer hohen Nutzerzahl. Das wird teuer.
Viel früher wird die kilometerabhängige Maut Realität werden. Technisch ist sie kein Problem, den Lkw-Mautsystemen ist es egal, ob sie Lkw oder Pkw erfassen. So können die kleinen Geräte, die in Tschechien ab 2011 die Klebevignette ersetzen sollen, entsprechend adaptiert werden.
E benfalls kein Problem wäre es, die Maut nach unterschiedlichen Tarifen zu verrechnen, für Klimasünder und ökologische Autos. Wahrscheinlichkeit: groß. Die Politik sperrt sich aus Angst vor dem Wähler noch dagegen. Doch Klimaschutz wird immer wichtiger, der Druck, die wahren Kosten zu berechnen, steigt. Im derzeitigen Vignetten-System sind Vielfahrer deutlich besser gestellt. Noch ein Grund für die Pkw-Maut: Die Staatskassen sind leer. In Deutschland drängt die Regierungspartei FDP deswegen bereits auf eine Pkw-Maut.
Ständig unter Kontrolle
Würden auf jedem Straßenabschnitt in Österreich regelmäßig Geschwindigkeitsproben genommen, könnte das die Sicherheit enorm erhöhen, drängt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf eine solche Maßnahme. Mit dem Zu-schnell-Fahren, der Unfallursache Nummer eins, wäre es dann vorbei. Außerdem würde dies zusätzliche Einnahmen generieren und gleichzeitig die Kosten für die Polizeikontrollen verringern.
Wahrscheinlichkeit: gering. Siemens hat die Technologie dafür, doch die Widerstände sind groß. Autofahrerclubs argumentieren, dass das die Freiheit des Einzelnen zu sehr einschränken würde. Außerdem ist dem System stets bekannt, wo sich welches Auto befindet. Davor warnen Datenschützer.
Bei der Section Control könnten Fahrer theoretisch noch kurz Gas geben, wenn sie später sehr langsam fahren und auf den Durchschnitt achten. Bei einer ins Fahrzeug eingebauten Elektronik, die auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit achtet und bei Überschreitung einschreitet, wäre es auch damit vorbei. Wahrscheinlichkeit: mittel. In Frankreich gibt es diesbezügliche Testläufe für Intelligent Speed Adaption, die Widerstände aus Freiheitsgründen sind groß. Möglicher Kompromiss: Die Fahrer können mit einem Kick-down-Schalter den Bordcomputer „overrulen“.
City-Maut bereits Realität
Die City-Maut ist weltweit schon Realität: in London, Stockholm, Singapur, Mailand oder Rom. Auch Prag und Budapest wollen 2010 den Verkehr damit eindämmen. Wahrscheinlichkeit: bis 2030 hoch. Besonders in Städten mit klar definierten Stadtkernen ist die Einführung kein großer Aufwand. Es genügen Mautbalken an den Einfahrtsrouten und Videokameras zur Überwachung.
In Österreich versucht die Wiener Stadtregierung, derzeit das Verkehrsproblem noch mit Parkraumbewirtschaftung mittels Parkpickerln für die jeweiligen Bewohner der Bezirke und Parkscheinen einzudämmen, doch die Bevölkerung in Wien und am „Speckgürtel“ wächst. Autos in Parkgaragen oder Firmenparkplätzen lassen sich mit der Parkraumbewirtschaftung nicht erfassen.
Umfassende Navigation
Bereits heute zeichnet sich ab, wie sich die Welt der GPS-gestützten Navigation weiterdrehen wird. Das europäische Satellitensystem wird in wenigen Jahren einsatzbereit sein und noch mehr Qualität in die Navigation bringen. Davon ist Alexander Frötscher, Senior Projekt-Manager bei Austriatech, der Telematik-Tochter des Verkehrsministeriums, und uständig für das EU-Projekt Coopers, überzeugt. Bei Coopers, dessen Bestandteile künftig den europäischen oder sogar weltweiten Verkehr „beeinflussen“ werden, wird Navigation eine von vielen Funktionen sein. Geschwindigkeitsbegrenzungen, Verkehrsschilder oder Wetterwarnungen werden über ein zentrales Gerät im Fahrzeug angezeigt. Technisch wäre es einfach möglich, den Autofahrer zur Geschwindigkeitsbegrenzung zu zwingen. „Doch da sträubt sich nicht nur die Autoindustrie dagegen“, so Frötscher gegenüber economy. Coopers-Funktionen sollen den Fahrer einfach überzeugen. Frötscher: „Selbst wenn es technisch funktioniert, wissen wir nicht, wie sich die Fahrer darauf einstellen.“ Den Druck vom Gaspedal nehmen oder einen Spurwechsel durchführen wird auch künftig nur der Fahrer selbst können.
Wahrscheinlichkeit: bereits in Entwicklung. Die EU fördert dies anhand mehrerer Projekte. Coopers wird in Wien von Austriatech entwickelt und von Partnern wie Asfinag, BMW, Efkon, Kapsch Traffic Com, ORF und der Technischen Universität mitgetragen. Erste Funktionen werden in der nächsten Generation von Mautgeräten eingebaut werden. Ab 2015 soll es die ersten operativen Systeme geben. Zehn Jahre später wird ganz Europa versorgt sein.
Aber auch die Anbieter von Navigationssoftware werden einen großen Beitrag in diesem Bereich leisten. Die Verschmelzung von Mobilfunk und Navigation ist schon heute im Gange. So liefern Navigon und Tom Tom bereits heute Lösungen für Smartphones, die bereits mit GPS und Kompass ausgerüstet sind. Auf der anderen Seite werden Navigationsgeräte, egal ob fix vom Autohersteller eingebaut oder nachgerüstet, über Mobilfunk mit dem Internet verbunden sein und etwa die Anzahl der freien Parkplätze im nächstgelegenen Parkhaus anzeigen. Einen weiteren Trend sieht Jochen Katzer, Manager R&D Pre-Development bei Navigon, in der Ausweitung der Navigation auf den öffentlichen Verkehr, Fahrrad oder Fußmarsch. Gefragt sei der geschickteste Weg hinsichtlich Kosten oder Umweltkriterien. Wahrscheinlichkeit: sehr hoch.
Eine Karte für alles
Die Mobilitätskarte sieht vor, dass alle Verkehrsmittel mit einer Karte benutzt werden. Der Fahrpreis wird automatisch berechnet und von einem Guthaben mit Bestpreisgarantie abgebucht oder wie bei der Telefonrechnung im Nachhinein verrechnet.
Wahrscheinlichkeit: hoch. Die Papierwirtschaft wird irgendwann lästig. Kann sich in Zeiten der E-Card noch jemand Krankenscheine auf Papier vorstellen? Die Wiener Linien wehren sich bisher erfolgreich gegen die M-Card, weil sie die Philosophie des offenen Systems gefährdet sehen – die M-Card wäre der elektronische Türöffner für die U-Bahn, Tram oder S-Bahn. Der VCÖ meint, der Zugang könnte trotzdem offen ohne Drehkreuze bleiben, mit Kontrolleuren in den Zügen, die überprüfen, ob die M-Card beim Einsteigen aktiviert wurde.