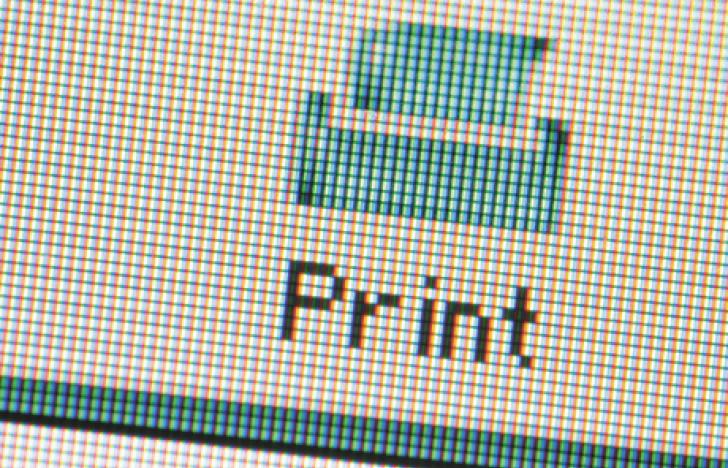Titel, Tore, Transaktionen
 EPA
EPADie Gehaltspirale von Berufssportlern dreht sich immer schneller und in astronomische Höhen. Mit der Ablösesumme von 300 Millionen Euro für Lionel Messi von FC Barcelona ist nur der vorläufige Höhepunkt erreicht.
Rainhard Fendrich sang schon früh ein Loblied auf den Sport. Dieser ist heute für Aktive, Manager, Vereine und Konzerne zu einer Branche geworden, in der Millionen verdient und Milliarden bewegt werden. Während Unternehmen um ihr Überleben zittern, wechselt Cristiano Ronaldo für „königliche“ 94 Mio. Euro zu Real Madrid, überweist Bayern München 30 Mio. für Mario Gómez nach Stuttgart, und selbst Austro-Star Erwin Hoffer ist dem SSC Neapel fünf Mio. Euro wert.
Von einer von Experten befürchteten „Überhitzung“ auf den Transfermärkten ist auch in der Saison 2009/2010 offensichtlich nichts zu spüren. Angesichts alles andere als moralisch zu nennender Summen für junge, neue Spieler stellt sich die Frage, wann die Fußballvereine für ältere Spieler ebenfalls „Abwrackprämien“ erhalten werden.
TV und Waschmaschine
Es mutet wie im Märchen an: 2500 D-Mark, einen Schwarz-Weiß-Fernseher und eine Waschmaschine bekamen die deutschen „Helden von Bern“ für den Fußballweltmeistertitel 1954. Mit 1250 Euro gibt sich heute kein Profi mehr zufrieden. Für den Triumph bei der WM 2006 im eigenen Land hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 300.000 Euro Prämie in Aussicht gestellt – pro Spieler, versteht sich. Es war die höchste Prämie in der DFB-Historie, dreimal so hoch wie bei der WM 2002 in Südkorea und Japan. Damals hätte es für den Titelgewinn „nur“ 92.000 Euro gegeben.
Zum Vergleich: 1974 hatten Franz Beckenbauer und Co für den WM-Sieg 60.000 D-Mark plus ein Käfer Cabrio erhalten. Für den Titelgewinn 1990 waren 130.000 D-Mark ausgelobt. Den Titelgewinn bei der „Euro 2008“ in der Schweiz und Österreich hätte sich der DFB 250.000 Euro pro Spieler kosten lassen. Ein Nichts im Verhältnis zu den Prämien der österreichischen Spieler, die sogar Millionäre hätten werden können. Denn der österreichische Verband wollte die kompletten Prämien der Europäischen Fußball-Union (Union of European Football Associations, Uefa) an seine Spieler ausschütten. Bei 7,5 Mio. Euro Antrittsprämie wären das schon allein 326.000 Euro pro Kopf, bei drei Niederlagen in der Vorrunde. Für ein „Wunder von Wien“ hätte jeder Spieler knapp 1,2 Mio. Euro
kassiert.
Kasse machen Spieler heute vor allem durch Werbung. „Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch!“, forderte 1967 Franz Beckenbauer, die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Nach Angaben der Werbeagentur Grey hat der spätere Werbemillionär für seinen Auftritt als „Suppenkasper“ gerade einmal 850 Euro erhalten. Experten schätzen, dass der „Kaiser“ im Lauf seiner Karriere über 40 Mio. Euro an Werbegeldern einnehmen konnte.
Eine horrende Summe, die sich jedoch neben den Einnahmen eines Michael Schumacher, der kürzlich beinahe für knapp 18.000 Euro pro Runde wieder ins Formel-1-Cockpit gestiegen wäre, oder gar im Vergleich zu Golf-Ass Tiger Woods, der laut Forbes Magazine im nächsten Jahr als erster Sportler weltweit mehr als eine Mrd. Dollar eingenommen haben wird, wie Taschengeld ausnimmt.
Primus Premier League
Die Ökonomisierung der beliebtesten Sportart, des Fußballs, und des Sports generell schreitet unaufhaltsam voran. Fußball wird immer häufiger als Produkt und damit bedeutender Wirtschaftsfaktor begriffen. Wenn eine Wirtschaftsbranche über 45 Jahre hinweg ein durchschnittliches Wachstum von fast zwölf Prozent erreicht, dann ist dies zweifellos beeindruckend. Seit Gründung der deutschen Fußball-Bundesliga haben sich die Umsätze der beteiligten Vereine gut verhundertfacht. Nicht weniger als fünf Mrd. Euro werden pro Jahr in Deutschland in und um den Fußball umgesetzt. Das Spiel mit dem runden Leder hat sich damit von einem Nischenmarkt zu einer Wirtschaftsmacht entwickelt, die längst mehr ist als die wichtigste Nebensache der Welt.
Finanziell entrückt vom Rest Europas war die Premier League schon lange. Mit dem Verkauf der Auslandsfernsehrechte ist man jedoch abermals in neue Dimensionen der globalen Vermarktung vorgestoßen. Eine Mrd. Euro kassiert die Liga nun in den kommenden drei Spielzeiten. Damit addiert sich der Erlös aus Medienrechten für die kommenden drei Jahre auf vier Mrd. Euro. Selbst Mitläufer wie Portsmouth können nun mit mehr als 50 Mio. Euro jährlich rechnen – mehr als der deutsche Meister. Vom Umsatz her erreicht die Liga mit 2,5 Mrd. Euro pro Jahr mittlerweile amerikanische Dimensionen, lässt die NHL (National Hockey League, Eishockey) hinter sich und nähert sich der NBA (National Basketball Association, Basketball).
Dimension Formel 1
Der Boom in der Formel 1 hält an und beschert dem Motorsport ausgezeichnete Umsatzzahlen, bei denen weder Fußball noch Football weltweit mithalten können. 217 Mio. Dollar wurden 2008 pro Rennen umgesetzt. Die Formel 1 fährt somit finanziell allen anderen Großereignissen im Sport mit Vollgas davon. Die Königsklasse des Motorsports setzt rund neunmal so viel wie die National Football League (NFL) um, die auf 24 Mio. Dollar (15,5 Mio. Euro) pro Spiel kam. Das ergab eine Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte.
Die Fußball-Bundesliga brachte es zum Vergleich auf sechs Mio. Dollar (3,9 Mio. Euro) pro Spiel. Die Formel-1-Gesamteinnahmen, bestehend aus den zentralen Erlösen aus Fernsehübertragungen, Sponsoring und Hospitality, den Teamerlösen aus Sponsoring und Investitionen der Teameigner sowie den Erlösen der Rennstrecken aus Kartenverkauf und Sponsoring, beliefen sich weltweit auf 3,9 Mrd. Dollar (2,5 Mrd. Euro). Die Erträge der NFL mit 6,5 Mrd. Dollar (4,2 Mrd. Euro) und der Major League Baseball mit 5,1 Mrd. Dollar (3,3 Mrd. Euro) waren zwar insgesamt höher, wurden jedoch in wesentlich mehr Veranstaltungen erzielt. Die Bundesliga kam auf insgesamt 1,9 Mrd. Dollar (1,4 Mrd. Euro).
Die Formel 1 erzielt nur zehn Prozent ihrer Gesamteinnahmen aus dem Ticketverkauf. Bei der Bundesliga stammen zum Vergleich 21 Prozent aus dem Absatz der oft heiß begehrten Eintrittskarten.