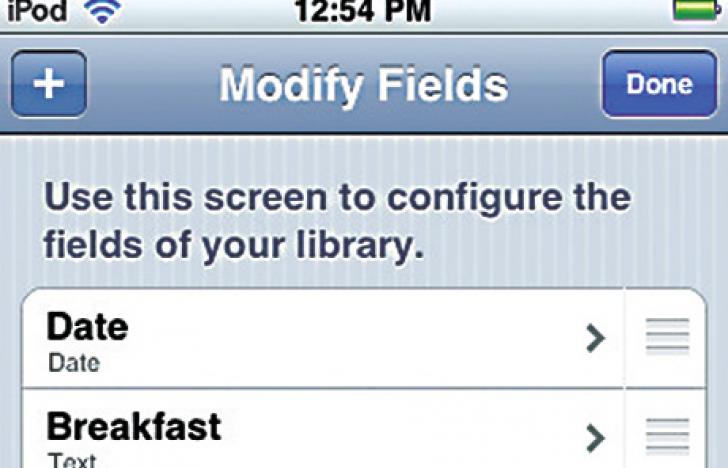Im Würgegriff der Meinungslenker
 DPA/Disney/Gene Duncan
DPA/Disney/Gene DuncanFünf der größten Medien- und Unterhaltungskonzerne der Welt haben ihren Sitz in den USA, wo sie ihren Aktionären dienen und weniger dem Bürger dabei helfen, Demokratie zu leben. Geballte Medienmacht führt zu Meinungsmonopol, Geschmacksdiktat, Kommerzialisierung und Unterdrückung des freien Geistes.
Wer nimmt der Welt den größten Teil der Meinungsbildung ab, und wer bestimmt, was Unterhaltung – zumindest im kommerziell verwertbaren Sinne – ist? Erraten: Amerika. Die fünf größten Medien- und Unterhaltungskonzerne haben ihren Sitz in den USA. Mit einem Umsatz von 46,5 Mrd. Dollar im Jahr 2008 steht Time Warner unangefochten an der Spitze. Zum Medienriesen gehören neben dem Nachrichtensender CNN und den Filmstudios von Warner Brothers auch verschiedene Fernsehkanäle wie HBO und Magazintitel wie Time, People und Fortune.
Gut geht es dem Dinosaurier nicht: Im Schlussquartal 2008 schockte Time Warner seine Shareholder, darunter Capital Research, Axa, Barclays und Morgan Stanley, mit einem Rekordverlust von 16 Mrd. Dollar, die durch Abschreibungen verursacht wurden. Es kriselt an allen Ecken und Enden: bei der Kabelsparte, im Internet und im Verlagsgeschäft.
Disneys Medienwelt
Der zweitgrößte Medienkonzern der Welt ist die Walt Disney Company mit 36,4 Mrd. Dollar Umsatz. Doch die kommen schon lange nicht mehr von den Comics, sondern von den Filmstudios, darunter Miramax und Touchstone, den Animationsstudios inklusive Pixar sowie Fernsehkanälen wie ABS, Disney Channel und Super RTL als auch natürlich den Themenparks. Zwar machte Disney 2008 einen Gewinn, doch dieser fiel 2008 um sechs Prozent auf 4,4 Mrd. Dollar.
Es folgt die News Corp von Richard Murdoch, ein Konzern mit mehr als 400 Firmen rund um die Welt, mit so schillernden Zeitungen wie The Times und The Sun in London, New York Post, Boston Herald, Chicago Sun und, nicht zuletzt, das Fox Network und in Europa mit einem Minderheitsanteil an Premiere (bald Sky). Mit 31,4 Mrd. Dollar Umsatz im Jahr 2008 musste Murdoch aber doch einen 30-prozentigen Gewinnrückgang auf immerhin noch drei Mrd. Dollar hinnehmen.
Auf Platz vier der Rangliste folgt Viacom, 28 Mrd. Dollar an Umsatz schwer (inklusive des abgespaltenen CBS-Networks). Hier tummelt sich alles, was hip und cool ist: MTV, Paramount, Dreamworks, Nickelodeon, Sega of America, Viva, Comedy Central sowie der Blockbuster-Videoverleih. Der Nettogewinn schrumpfte 2008 um stattliche 32 Prozent auf 1,25 Mrd. Dollar; unter anderem belastete die Videoverleihkette Blockbuster sehr stark.
Comcast, der fünftgrößte Medienkonzern, ist hauptsächlich im Kabelnetzgeschäft und den dazugehörigen Inhalten, vor allem Sportübertragungen, tätig. Mit rund 25 Mrd. Dollar und 2,6 Mrd. Dollar Gewinn läuft das Geschäft ganz gut. Comcast ist einer jener Konzerne, die massive Störsignale für Filesharing-Nutzer von Bittorrent aussenden, um den Dateiaustausch zu unterbinden.
Freiheitsberaubung
Die Konzentration von Öffentlichkeitsmacht in vier Medien- und einem Infrastrukturkonzern ist ein Zustand, der seit jeher Kritik hervorgerufen hat. Von einer „freien Presse“, die die Gründerväter der USA in die Verfassung geschrieben haben, kann dabei keine Rede mehr sein, von wenigen Ausnahmen abgesehen.
„Die Medienkonzentration führt zu zwei zentralen Problemen: extremer Kommerzialisierung und Vernachlässigung des Dienstes am Bürger“, schreibt der US-Medienkritiker und Professor an der Universität von Illinois, Robert McChesney.
Die US-Medien bestünden aus einer „Handvoll enormer Konglomerate, die sich die monopolistische Kontrolle über weite Teile der Medienlandschaft gesichert haben“, so McChesney. „Die Oligopole spotten der traditionellen Vorstellung einer freien Presse, in der jeder am freien Markt der Ideen teilhaben kann. Dabei werden die Monopole von Jahr zu Jahr erdrückender.“
Das Grundproblem sieht er in der kommerziellen Struktur der Medienkonzerne als Aktiengesellschaften, wodurch sie nicht mehr dem Bürger und damit der Demokratie dienen würden, sondern den Aktionären. Und um das tun zu können, müssen sie profitabel sein und die Interessen der großen Konzerne vertreten, die den Großteil der Medien mit ihren Werbegeldern finanzieren. Die politische Kaste revanchiert sich mit der Zuteilung von Lizenzen für Wohlverhalten. Dass dabei kritischer Journalismus zur Demokratieförderung hinter zahnlosem Medienbrei und stumpfer Dauerunterhaltung zurückbleibt, ist die logische Folge, so McChesney.
Deutscher Mogul
Zurück zu den Medienriesen: Auf Platz sechs folgt mit Bertelsmann der erste europäische Medienkonzern in den Reihen der ganz Großen. Das Unternehmen mit Sitz in Gütersloh kontrolliert Gruner + Jahr, RTL, Random House sowie die Infrastrukturtochter Arvato und Buchgemeinschaften, Buchhandlungen und Online-Vertriebe.
Der Umsatz betrug im Jahr 2008 16,1 Mrd. Euro mit gleichbleibender Tendenz, doch der Vorsteuergewinn ging hauptsächlich durch Abschreibungen um fast neun Prozent auf 1,6 Mrd. Euro zurück. In Österreich ist Bertelsmann über Gruner + Jahr an der News-Gruppe (E-Media, Format, News, Profil und andere) beteiligt.
Der Oberlobbyist hinter der Bertelsmann-Gruppe ist der 80-jährige Medienmogul Reinhard Mohn, ein ehemaliger Buchhändler und heute Eigner der Bertelsmann-Stiftung, die 76 Prozent an Bertelsmann hält – der Rest gehört der Familie Mohn direkt. Der Zweck der Stiftung lautet nach Eigendefinition: „konkrete Beiträge zur Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme“. Schöner könnte man die Absicht, die Willensbildung in einer Demokratie durch Ausübung medialer Macht zu beeinflussen, kaum beschreiben. Und das Erstaunliche daran ist: Es funktioniert.
Economy Ausgabe 73-05-2009, 29.05.2009