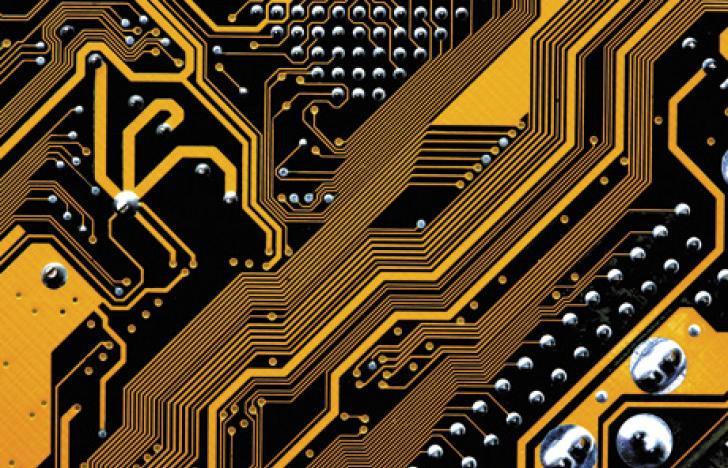Seltsame Weltmeister im Abseits
 dpa/ratilainen
dpa/ratilainenLuftgitarren-WM, Handy-Weitwurf-WM, Sauna-Sitz-WM, WM im Frauentragen – kreative Finnen tragen einen wesentlichen Teil zur modernen Spaßgesellschaft bei. Die Anzahl derartiger Events steigt rasant, und immer mehr österreichische Teilnehmer mischen dabei kräftig mit.
Das Wasser spritzt meterhoch nach allen Seiten, die Zuschauer johlen auf den Rängen. Die Wertungsrichter benoten die eben gezeigte Sprungfigur relativ unspektakulär. Technik, Absprung, Inszenierung des Athleten, Lautstärke beim Aufprall und Spritzhöhe des Wassers fließen in ihre Bewertung ein. Nur manchmal ziehen sie sich den Unmut des Großteils jugendlichen Publikums zu.
Dass dieser Wettbewerb eine lange Tradition besitzt und schon im 17. Jahrhundert von den Ureinwohnern Hawaiis mit Klippensprüngen praktiziert wurde, interessiert hier niemanden. Seit der Wiederentdeckung genießt die Arschbomben-WM als Funsportart hohes Ansehen. 2008 bestiegen mehr als 80 Titelkämpfer den Zehn-Meter-Turm im Nürnberger Stadionbad, um als Weltmeister der Arschbombe aus dem Sprungbecken zu steigen.
Ein Einzelphänomen? Wohl kaum, denn beinahe jedes Land entwickelte in den letzten Jahren seine eigenen weltmeisterlichen Wettbewerbe. Die Franzosen üben sich beispielsweise im bretonischen Örtchen Mogueriec im Strandschnecken-Spucken, wobei die Rekordmarke vom fünffachen Weltmeister Alain Jourden (48) bei 10,40 Meter liegt. Nahezu angenehm gemütlich geht es vergleichsweise alljährlich am Karfreitag im britischen Tinsley Green bei der Austragung der Murmel-WM zu. Und während am 30. März dieses Jahres in Thailand die Weltmeisterschaften im Elefanten-Polo zu Ende gingen, wurden 14 Tage zuvor im deutschen Winterberg die Four-Gates-Aua-Handballer aus Menden bei Bochum zu Weltmeistern in der Schneeballschlacht gekürt.
Ob Sumpfschnorcheln in Llanwrtyd Wells (Wales), Kakerlaken-Wettrennen in Brisbane, Zehen-Wrestling in Derbyshire, Extrembügeln – auch unter Wasser sowie in Felshängen – oder Tabakschnupfen, der Kreativität im Erfinden neuer Wettbewerbe scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Es gibt nicht wenige, die mal Erster in der Kategorie Bürostuhlrennen sein möchten oder sich zum Papierflug-Weltmeistertitel in den Disziplinen der weiteste Flug, die längste Flugzeit und die schönste Performance gratulieren lassen wollen. Von insgesamt über 37.000 Anwärtern weltweit qualifizierten sich 253 aus 85 verschiedenen Ländern für das Finale, das Anfang Mai dieses Jahres im Hangar 7 in Salzburg stattfand.
Wettbewerbserfinder
Puterrot verschwitzt verließ Bjarne Hermansson nach 18 Minuten und 15 Sekunden im finnischen Heinola nach 36 Aufgüssen als Weltmeister 2008 die 110 Grad Celsius heiße Sauna. „Der Schmerz ist dieses Mal ein bisschen größer gewesen als das Vergnügen“, meinte er nach der hitzigen Sitzung. Ins selbe Lied könnten wohl die Teilnehmer der WM im Frauentragen einstimmen, die heuer am 4. Juli bereits zum 17. Mal in Sonkajärvi ausgetragen wird. „Daran wollte ich einmal teilnehmen“, erzählt der österreichische Anzeigenberater Micky Klemsch (42), „aber dafür musst du verheiratet sein.“ Dass er trotzdem als Drittplatzierter in die WM-Annalen einging, verdankt er der Handy-Weitwurf-WM.
„Ich war damals lange mit einer Finnin verlobt, und wir haben eine Website aufgebaut, die Skurrilitäten aus beiden Ländern publizierte. Darunter waren diese Weltmeisterschaften.“ Bei seiner ersten Teilnahme im Jahr 2004 war er neben 20 Finnen einer von sieben weiteren Europäern.
Zufälligerweise fand am Folgetag „nur 500 Kilometer entfernt“ auch die Luftgitarren-WM statt, zu der sich Micky Klemsch umgehend anmeldete, um diese Idee als Veranstalter nach Österreich zu exportieren. Mit seinen WM-Teilnahmen schaffte es der in Medienkreisen Beheimatete auf die Titelseiten der Zeitungen, war Gast in Kölner Fernsehstudios, gab Radiointerviews, und auch der Kultursender Arte widmete dem Drittplatzierten im „Österreich-National-Team“-T-Shirt einige Fernsehminuten. „Für mich ging es mehr darum, eine Gaudi zu haben und bestenfalls die Musikindustrie zu verarschen oder Sportveranstaltungen als nicht ganz so ernst zu nehmende Events darzustellen.“
Sieben Jahre lang organisierte der ebenfalls als DJ tätige Klemsch die österreichischen Meisterschaften in der Kategorie Luftgitarre, um ernüchtert festzustellen: „Nach drei bis vier Jahren war der Spaß vorbei. Wir waren zwar im Nachrichtenblock das Bonmot am Ende, aber es stellt sich auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit, wenn 16-Jährige in einer Waldviertler Disco nur mehr besoffen die Bühne betreten, weil sie sich sonst nicht trauen.“
Erlebe dein Leben
Als Meister der Vermarktung derartiger Veranstaltungen gilt der deutsche Fernsehmoderator Stefan Raab. Seine medientauglichen Realisierungen bringen nicht nur hohe Einschaltquoten, sondern auch Prominente dazu, einen Eiskanal, der üblicherweise mit Bob oder Rodel absolviert wird, in einer hohen, durchgängig gewölbten Wok-Pfanne runterzufahren oder an der Autoball-EM teilzunehmen. Hier muss man im Auto sitzend versuchen, einen überdimensionalen Ball im Tor des Gegners unterzubringen.
Die Soziologie hat für diese Form der massenhaften Selbstinszenierung die Begriffe „Erlebnisgesellschaft“ und „Spaßgesellschaft“ determiniert. Glückseligkeit zählt dabei zum obersten Ziel der Teilnehmer, die sich auf die individuelle Suche nach einem besonderen Erlebnis begeben, um das eigene Leben möglichst interessant zu gestalten. Egozentrische Selbstverwirklichung und individuelle Erlebnissuche summieren sich zum alles bestimmenden Handlungsimperativ: „Erlebe dein Leben!“
Dabei sein ist alles
„So leicht komme ich nie wieder zu einer WM-Teilnahme“, begründet Gerald Gruber (40) seine Motivation für die Teilnahme an der Snowkajak-WM 2008 in Lienz. Sich selbst bezeichnet er als Sportler, der Extremsportarten betreibt, ohne einen Wettbewerbsgedanken zu hegen. Und so nahm er auch schon mit Freunden am „Dolomitenmann“ teil, übt das Paragleiten und Eisklettern aktiv aus oder nahm ohne Vorbereitung am Wien-Marathon teil, denn: „Laufen lernst du ja schon als kleines Kind.“
Bereits 2006 probierte der spätere WM-Teilnehmer Gruber die Fortbewegungsmöglichkeit, einen schneebedeckten Hang mit einem Kajak hinunterzufahren, nachdem er diese eigentümliche Sportart im Internet gesehen hatte. Als einer von 140 Power-Paddlern aus zwölf Nationen erinnert er sich: „Das Material war vorhanden, und Zeit hatte ich auch. Die Vorbereitung absolvierte ich auf einer Autobahnraststätte, indem ich den mit Rissen durchzogenen Bootsrumpf noch rasch eine halbe Stunde lang pflegte.“ Zum Sieg reichte es logischerweise nicht. „Der Gesamtsieger hatte sein Kajak mit Kerzenwachs eingewachst.“
Economy Ausgabe 73-05-2009, 29.05.2009
 Photos.com
Photos.com