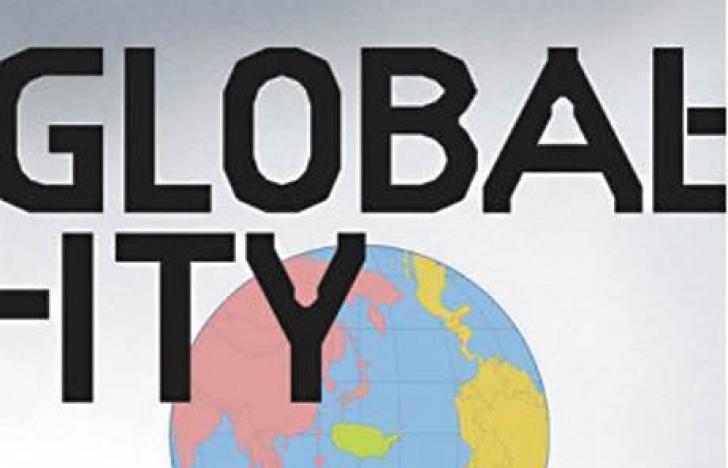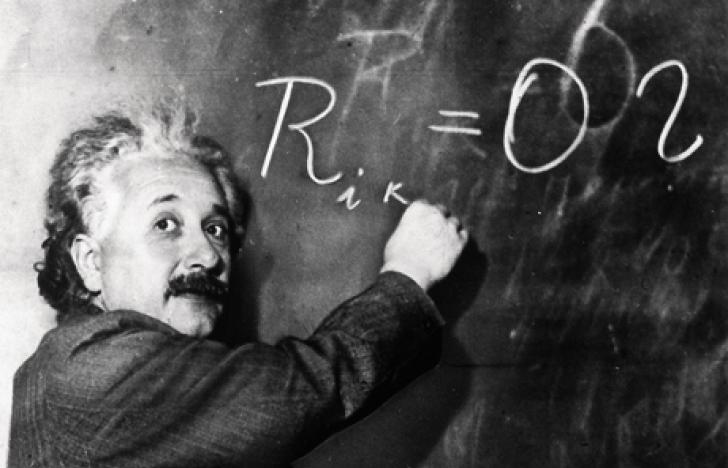Europa ist nicht nur weiß
 Andy Urban
Andy UrbanMillionen von Menschen zieht es nach Europa. Es lockt die Vorstellung von Wohlstand und Sicherheit. Bei politischen Flüchtlingen ist das anders. Sie flüchteten, um ihr Leben zu schützen. Fünf Neu-Europäer erzählen, warum sie nach Europa kamen und wie sie ihre neue Heimat sehen.
Sie ertrinken. Sie ersticken. Auf ihrem Weg in das Traumland Europa gehen viele Menschen jedes Risiko ein. Und das ist hoch, seit sich Europa zur Festung ausgebaut hat. Jedes Jahr ertrinken Tausende Menschen im Mittelmeer, wenn ihr Boot zwischen Afrika und der italienischen Insel Lampedusa, dem südlichsten Punkt Europas, kentert. Immer wieder ersticken Menschen, wenn sie sich von Schleppern als Lastgut in Lkws über die Grenzen bringen lassen.
Nicht jede Flucht ist so dramatisch. Die Gründe, in Europa eine neue Heimat zu suchen, sind es oft schon. Sei es, weil sich Menschen aufgrund von Armut nicht mehr ernähren können, weil ein Krieg das nackte Überleben gefährdet, weil sie aus politischen, religiösen, ethnischen oder sonstigen Gründen bedroht werden. Menschen, die in Österreich Asyl erhielten oder sich aus anderen Gründen für ein Leben in Österreich entschieden haben, reflektieren ihr Bild von Europa.
Simon Inou, Journalist
„Die Berggasse kannte ich aus dem Geschichtsunterricht“, sagt Simon Inou. „Sigmund Freud, Berggasse, die Hofburg-Familie, Schönbrunn – lauter barbarische Namen, die wir in der Schule nicht verstanden.“ Er hatte, so wie alle Schüler in Kamerun, intensiv europäische Geschichte gelernt. Und gerätselt, wie sich Schnee anfühlt.
Doch es war nie sein Traum, nach Europa zu gehen. Er wollte gegen die Diktatur, die Korruption in Kamerun anschreiben. Er war Journalist, hatte bereits eine Zeitschrift für junge Leute gegründet. Als er zu einem Journalistenkongress nach Graz eingeladen wurde, sagte er seiner Mutter, er würde in zwei Wochen wieder zurück sein. Das war vor 13 Jahren. Während der Konferenz erfuhr er, dass er nach der Rückkehr wegen seines Engagements für Minderheiten und Umweltschutz verhaftet werden würde. Journalisten in Graz rieten ihm, um politisches Asyl anzusuchen. „Asyl, was ist das?“, fragte er.
Das Innenministerium, damals von Caspar Einem geleitet, prüfte den Fall und erkannte Inou nach relativ kurzer Zeit als Flüchtling an. Er könnte längst die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Aber: „Ich bin immer noch ein Flüchtling. Ich bin noch nicht bereit, Österreicher zu sein. Da habe ich ein Identitätsproblem.“ Seine wahre Identität hängt sowieso nicht an einer Nationalität, sondern an einem Beruf. „Ich will schreiben. Ich will mich engagieren. Das mache ich nicht aus Karrieregründen, sondern von Herzen.“ In Kamerun hätte er gegen die politischen Zustände angeschrieben und wahrscheinlich öfters sein Leben riskiert. In Österreich hat Inou die rassistische, oberflächliche oder unsensible Berichterstattung über Afrikaner in österreichischen Medien aufgedeckt. Etwa, wenn Medien Afrikaner pauschal mit Drogendealern gleichsetzen.
Inou hat die Online-Infoplattform Afrikanet gegründet, wirkt bei Radio Afrika mit und koordiniert seit eineinhalb Jahren eine jeden Mittwoch in der Tageszeitung Die Presse erscheinende Seite, auf der Journalisten und Journalistinnen mit Migrationshintergrund schreiben.
In anderen Lebensbereichen wirkt er im Augenblick resignativ. „Ich gehe nicht mehr tanzen. Weil ich vermeiden will, dass mir der Türsteher einer Diskothek sagt: ‚Keine Schwarzen.‘ In Wien gibt es Lokale, wo ich nicht essen darf. Ich werde nicht bedient. Aber ich lasse mich nicht unterdrücken.“ Viele Leute, die diskriminieren, würden eines Tages bemerken: Das war falsch. Zum Glück hätten seine Kinder in der Schule keine Probleme. Sie gehörten aber auch zu den Besten.
Keine Identitätsprobleme gibt es bei Loyalitäten im Sport: „Wenn es um Fußball geht, unterstützen meine Kinder und ich immer Kamerun oder ein anderes afrikanisches Team. Wenn es um Skifahren geht, sind wir für Österreich. Denn Kinder wollen immer die Sieger sein.“
Aftab Husain, Literat
Der pakistanische Literaturprofessor Aftab Husain hatte es so gut gemeint. Zwischen Pakistan und Indien gab es gerade ein Lüfterl Entspannung. Indiens Premierminister Atal Behari Vajpayee stattete 1999 Pakistan einen Staatsbesuch per Autobus ab, um die Grenze der verfeindeten Staaten zu öffnen. Husain wollte ein Zeichen setzen, übersetzte Gedichte, die Vajpayee geschrieben hatte, von Hindi in die pakistanische Nationalsprache Urdu und präsentierte dem Premier das Büchlein.
Dann brachen wieder Spannungen aus, und Pakistans Premier Nawaz Sharif wurde gestürzt. Husain bekam Besuch vom pakistanischen Geheimdienst ISI. Er möge doch bestätigen, dass die Übersetzung im Auftrag von Sharif erfolgte. Als Husain dem ISI nicht zu Diensten sein wollte, wurde sein Haus geplündert und seine Familie misshandelt. Husain flüchtete nach Indien. Doch die indische Regierung zögerte, ihm Asyl zu gewähren. Der internationale Schriftstellerverband PEN hörte von den Troubles des Gedichteübersetzers und lud Husain nach Deutschland ein. Später kam Husain als „Writer in Exile“ nach Wien. Aus Sicherheitsgründen wollte er sich nicht fotografieren lassen.
„Österreich ist ein sehr netter Ort“, sagt Husain. Sehr ruhig sei es halt. Der Literat fühlt sich in der fremden Kultur
etwas verloren. „Ich vermisse Bücher auf Urdu. Ich bin mit der Urdu-Sprache, mit der Literatur aufgewachsen. Englisch ist die Sprache unserer intellektuellen Gedanken. Aber nicht unseres emotionalen Lebens.“
Bestimmte kollektive Vorurteile über Europa würde Husain gern zurechtrücken: „In Südasien halten wir uns für Bewahrer der menschlichen Werte, als Ort der Poesie und Kunst und meinen, die Europäer würden nur an sich und Geld denken. Würden sie uns aber fragen, mit welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen wir zum Wohl der Menschheit beitragen, stünden wir mit leeren Händen da.“
Béatrice Achaleke, Aktivistin
„Oh Gott“, sagt Béatrice Achaleke auf die Frage nach ihrer Herkunft – und dann ziemlich forsch: „Ich komme aus Breitenfurt. Nach Wien ging ich, um zu studieren.“ Die ständige Fragerei, woher sie denn komme, geht ihr auf die Nerven. Deswegen verweigert sie oft die Antwort. Es ist ihre Strategie, mit der Doppelbödigkeit umzugehen, der sie sich als Migrantin ausgesetzt fühlt. Die Gesellschaft fordert, dass sie sich integriert, behandelt sie aber dennoch als eine „sichtbar Andere“. „Ich bin österreichische Staatsbürgerin und möchte auch als solche behandelt werden.“
Die Entscheidung, Österreicherin zu sein, hat Achaleke auch wegen ihrer hier geborenen Kinder getroffen. „Ich möchte nicht, dass sie irgendwann das Gefühl haben, ihre Mama sei immer die Ausländerin. Den Gastarbeitern warf man vor, zwischen zwei Welten zu leben. Ich habe für mich gewählt: ‚Hey, Kinder, wir sind hier zu Hause!‘“ So sollen ihre Kinder besser damit umgehen können, wenn man ihnen sagt, sie seien Ausländer, weil sie anders als die klassischen Österreicher aussehen.
Zu ihren Wurzeln steht sie dennoch. „Meine Kinder haben afrikanische Namen, ich kleide mich kamerunisch, ich koche kamerunisch. Aber ich wähle aus, welche Identität ich wann benutzen will.“
Achaleke ist politisch aktiv. Sie leitet die Organisation Afra (International Center for Black Women’s Perspectives) in Wien. Sie engagiert sich für ein Antidiskriminierungsgesetz, das seinen Namen verdient, für Chancengleichheit und Mitbestimmung schwarzer Frauen in der Europapolitik. „Ich möchte dorthin, wo die Entscheidungen getroffen werden. Ich möchte mich einmischen. Aber nicht als schwarzes Aushängeschild und Alibiprojekt österreichischer oder europäischer Politiker.“
Die politischen Parteien und Institutionen müssten sich öffnen, um Chancengleichheit aller Bürger und Bürgerinnen zu ermöglichen. Allein zu sagen, man sei gegen Rassismus, genüge nicht. Wiens Politiker beteuern „Wien ist eine offene Stadt“ oder „Wien braucht euch“, um Migranten für die Polizei anzuwerben. Gleichzeitig wird ein Schwarzer in der U-Bahn von Polizisten brutal niedergeschlagen. „Daran zeigt sich, dass die propagierte Öffnung und das Streben nach Vielfalt bloße Lippenbekenntnisse sind.“
Dasselbe gilt für Schlagworte wie „grenzenloses Europa“. „Ich kenne Europas Grenzen genau“, sagt Achaleke. „Man braucht nur an die Grenzen von Italien und Spanien schauen und beobachten, was auf hoher See passiert.“ Die EU wisse genau, warum so viele Afrikaner aus Afrika flüchten. Weil die Lebensgrundlagen von Afrikanern von der EU-Politik systematisch beschnitten werden. In der Fischerei etwa. Seit 15 Jahren fischen europäische Schiffe ganze Küstenstreifen, beispielsweise an der Küste Senegals, leer. Für die einheimischen Fischer in ihren kleinen Booten bleiben kaum mehr Fische übrig.
Trotz dieser ökonomischen Realitäten, die den Afrikanern bewusst sind, ist das Europa-Bild in Afrika noch immer viel zu positiv. Wer es nach Europa schafft, erreicht Wohlstand. Das stimme mit der Realität nicht überein.
Was bewirkte die Wahl von Barack Obama zum US-Präsidenten? „Es gab eine Euphorie“, sagt Achaleke. „Und mein siebenjähriger Sohn möchte eines Tages österreichischer Verteidigungsminister werden.“
Bahram Parsa, Regisseur
Er steht jeden Morgen um fünf Uhr auf. Um diese Zeit gibt es via Satellit die besten TV-Nachrichten aus dem Iran. Er schreibt einen Blog. Auf Farsi. Seit sieben Jahren lebt Bahram Parsa in Wien. Doch ein Teil seines Ichs ist in Persien geblieben. Aufgrund seiner Arbeit als Künstler war er vom Mullah-Regime immer wieder verhaftet und gefoltert worden. Nach seiner Flucht aus dem Iran lebte er in Pakistan, Indien, Thailand, China, der Türkei. Überall fühlte er sich verfolgt. Er ging nach Sarajewo, nach Slowenien. Er benutzte gefälschte Pässe und verkleidete sich, je nach Bedarf, als belutschischer Bauer oder italienischer Mafioso. Die Rollenspiele beherrscht er. Bahram Parsa ist Schauspieler, Regisseur, Drehbuchschreiber. Und Anhänger des altpersischen Weisen Zarathustra. Damit stand er in Fundamentalopposition zum Regime der Mullahs im Iran.
2002 kam er nach Österreich und erhielt drei Jahre später politisches Asyl. Österreich ist seine neue Heimat. Er schätzt das Land, die Kultur, die gute medizinische Versorgung. Er hat Theaterstücke für Kinder geschrieben und inszeniert. Und er deckt Scheinheiligkeit auf, wo immer er sie sieht. Vor allem auch bei Flüchtlingen – wie jenem Tschetschenen, der in einem Supermarkt etwas gestohlen hatte. „Um vier Uhr morgens betest du zu Allah, um neun Uhr, zu Mittag, und jetzt stiehlst du?“, stellte Parsa ihn zur Rede. „Das sind ja Ungläubige“, erwiderte jener. „Diese Leute haben dir die Freiheit gegeben!“, rief Parsa. Empfindlich reagiert er auch auf islamische Vorstellungen von Sitte. „Das ist nicht richtig, dass sich ein Mädchen und ein Bursch auf der Straße küssen“, meinte eine Frau. Er sagte ihr: „Du bist in ihr Land gekommen. Wenn es dir nicht passt, geh zurück.“
Ghousuddin Mir, Jugendbetreuer
Auch Ghousuddin Mir ist vor radikalen Islamisten geflohen. Als Politiker in Afghanistan hatte er Konflikte mit islamistischen Kämpfern, den Mudschahedin. Ghousuddin war früher dem ÖVP-Politiker und Völkerrechtsexperten Felix Ermacora begegnet und bat ihn angesichts seiner Probleme um Hilfe. Durch diesen Kontakt gelang es ihm, nach Österreich zu kommen, seine Familie nachzuholen und politisches Asyl zu bekommen.
Jetzt arbeitet er als Jugendbetreuer in einem Don-Bosco-Heim – und hat dort immer wieder mit flüchtenden Afghanen zu tun. Auch privat prägt das Land seine Aktivitäten. Ghousuddin gründete einen afghanischen Kulturverein in Wien und schaffte es, die vielen Ethnien, die einander oft feindselig gegenüberstehen, zu gemeinsamen Feiern zu motivieren. Das war nicht selbstverständlich. Als einige Paschtunen ihren Führungsanspruch auch nach Österreich verlegen wollten, beschied er ihnen: „In Österreich sind wir alle Ausländer. Wir sind alle gleich. Also hört mit euren Kämpfen auf.“
Am Neujahrsfest „Nauroz“ nahmen kürzlich an die tausend Menschen teil. Als Star des Abends lud Ghousuddin eine berühmte Sängerin ein. „Ein afghanisches Neujahrsfest mit einer Sängerin als Star. Auch das ist ein Akt des Widerstands.“ Schließlich hatten die Fundamentalisten die Frauen aus der Gesellschaft ausgeschlossen und wollten die 5000 Jahre alte Kultur der Afghanen zerstören, indem sie traditionelle Feste verboten.
Astrid Kasparek, Margarete Endl, Economy Ausgabe 71-03-2009, 27.03.2009
 Visa
Visa