Kontinent in Bewegung
 Photos.com
Photos.comKulturen sind dynamische Einheiten, die sich immer wieder verändern. Der Versuch, eine „Festung Europa“ zu errichten, verkennt die evolutorischen Kräfte, die in der Geschichte dieses Erdteils gewirkt haben.
Die Katalanen sind ein stolzes Volk. Ginge es nach ihnen, gäbe es im Nordosten der Iberischen Halbinsel einen eigenen Staat Catalunya. Irgendwie fühlen sich die Katalanen nicht als „normale“ Spanier – und das zu Recht. Sie stammen nämlich von den Schweden ab; genauer gesagt: von den südschwedischen Westgoten. Als diese um das Jahr 400 auf der Suche nach neuen Siedlungsgebieten aus dem kalten Norden in den klimatisch günstigen Süden kamen, ließen sich Teile von ihnen an der nordwestlichen Küste des Mittelmeeres nieder. Sie gaben ihrer neuen Heimat den Namen „Gotalandia“, der später zu Catalunya romanisiert wurde.
Wenn heute die Europäische Union (EU) den Versuch unternimmt, sich in der „Festung Europa“ einzubunkern, dann verkennt sie die Lehren der Geschichte dieses Kontinents. Nicht erst seit der Völkerwanderung ist Europa ständig in Bewegung. Ströme von Menschen kamen, Ströme von Menschen gingen, und zu allen Zeiten waren Volksstämme, ja ganze Völker zwischen Ostsee und Mittelmeer, zwischen Atlantik und Schwarzem Meer unterwegs.
Das landläufige Bild des Alten Europa prägen die Schrecken verbreitenden Barbarenstämme. Doch waren das wirklich Europäer? Wie die Prähistorikerin Marija Gimbutas nachwies, existierte zwischen 7000 und 4000 vor unserer Zeitrechnung im Alten Europa eine hochstehende friedliche Zivilisation, die durch die Errungenschaften der Sesshaftigkeit das waren, was man heute „sozioökonomisch gut aufgestellt“ nennen würde: Ackerbau und Viehzucht warfen beste Erträge ab; es gab Töpferei, Weberei und Metallurgie; der Handel mit Obsidian, Marmor und Kupfer florierte über ein weitläufiges Netz von Handelsstraßen. Die Bauwerke der ersten entstehenden Städte stellen die Wiege der Architektur und bewusster Stadtplanung dar.
Eroberung und Kolonisierung
Zwischen 4300 und 2800 vor unserer Zeitrechnung wurde diese friedfertige Kultur von indogermanischen Reiterhorden, die aus den Steppen nördlich und östlich des Schwarzen Meeres kamen, in mehreren Invasionswellen überrannt und zerstört. Gimbutas nennt sie die „Kurgan-Völker“, weil sie große runde Grabhügel, russisch „Kurgan“ genannt, errichteten, in denen sie ihre Anführer bestatteten. Die „moderne“ indogermanisch-europäische Zivilisation, wie wir sie aus den Geschichtsbüchern kennen, war demnach die Folge von kriegerischer Eroberung und Kolonisierung.
Auch wer sich auf die Hochblüte des alten Griechenland als den europäischen Ursprung unserer Kultur berufen will, liegt damit falsch. Zum einen übernahmen die Griechen viele ihrer Ideen direkt von den Arabern, zum anderen brachten gerade die Araber erst im Mittelalter radikal neues Wissen und verfeinerte Lebensart (Stoffe, Gewürze, Düfte) nach Europa. Würden wir unser arabisches Erbe aus der europäischen Kultur tilgen, würde unser ganzes Weltbild zusammenbrechen.
Zwar stammen die „arabischen“ Zahlen aus Indien, aber wir rechnen damit. So mancher Schüler würde gern auf die Algebra (al-gabr) verzichten, doch wie funktionieren Computer ohne Algorithmen (al-Chwarizmi), wie das binäre System ohne die Zahl Null? Dieses ominöse Zeichen 0, das arabisch „sifr“ (leer) heißt und von dem unser Wort „Ziffer“ stammt. Alles arabische Importware, wie so vieles in der Mathematik, Chemie, Medizin, Astronomie und Philosophie. Selbst für manche unserer Genüsse hätten wir keine Namen und oft keine Rohstoffe: vom Kaffee (qahwa) über das Kiffen (kaif) bis zum Alkohol (al-kuhul).
Eindringlich erinnert auch der spanische Schriftsteller Juan Goytisolo in seinem Werk daran, dass die europäische Kulturgeschichte ohne das arabische Erbe einfach nicht zu erklären ist. Kultur kann für Goytisolo „heute nicht ausschließlich spanisch oder französisch oder deutsch sein, nicht einmal europäisch, sondern allein mestizisch, ein Bastard, ein Mischling, befruchtet von den Kulturen, die unserem abwegigen Ethnozentrismus zum Opfer gefallen sind“.
Stillstand ist das Gegenteil von Evolution. Auch Gesellschaften, Völker und Zivilisationen sind dynamische Organismen und keine statischen Gebilde. Sie sind in ständiger Bewegung, auch wenn der einzelne Mensch das in seiner kurzen Lebensspanne nicht so wahrnimmt. Seit vielen Jahrtausenden muss die politische Landkarte Europas immer wieder neu gezeichnet werden, denn Leben ist Bewegung. Oder wie uns der Literat Erich Fried wissen lässt: „Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.“
DEinen neuen Zugang zur Geschichte dieses Kontinents hat auch der Münchner Evolutionsbiologe Josef Reichholf in seinem Buch Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends vorgelegt, in dem er die in Europa immer wieder ausgelösten Migrationen vor dem Hintergrund der wechselnden klimatischen Lebensbedingungen für die Menschen beschreibt. economy sprach mit Reichholf über seinen naturgeschichtlichen Ansatz.
economy: Sie beschäftigen sich mit den Wechselwirkungen von Naturgeschichte und Geschichte. Welche Erkenntnisse bringt das?
Josef Reichholf: Da die Naturgeschichte meist nicht in die historische Betrachtung einbezogen wird, werden rückblickend oft Folgen und Ursachen verwechselt. Historische Vorgänge werden immer auch von den äußeren Lebensbedingungen mitverursacht. Die Menschenströme quer durch Europa, wie es sie zu vielen Zeiten gab, waren keineswegs nur politisch oder sozialpolitisch bestimmt. Sie waren auch das Ergebnis von natürlichen Rahmenbedingungen: was die Landwirtschaft produzieren konnte, ob es Hunger gab, welche Chancen bestanden, existenziell ein Auskommen zu finden. Die Evolution ergibt sich aus historischen Prozessen, die äußeren Zwängen, eben den Rahmenbedingungen, unterliegen und sich nicht beliebig entfalten können. Das ist für Menschen genauso gültig wie für Tiere und Pflanzen.
Um nicht zu weit zurückzugreifen: Lassen Sie uns beim Römischen Reich beginnen.
Die nördliche Grenze des Römischen Reiches, die durch den Limes markiert war, war auch die klimatische Grenze des Weinbaus. Etwas salopp formuliert: Jenseits dieser Grenze, wo kein Wein mehr gedieh, lohnte es sich aus Sicht der Römer nicht, zu leben. Sie rückten nur so weit vor, wie mediterrane Bedingungen gegeben waren. Wir müssen uns aber vor Augen halten, dass es zu jener Zeit wesentlich wärmer war als heute und Wein bis Mittelengland kultiviert werden konnte, wo dann der Limes die Grenze gegen Schottland bildete. Klarerweise spielten auch strategische Überlegungen eine Rolle, aber die natürlichen klimatischen Grenzen der mediterranen Lebensweise waren auch die Grenzen des
Römischen Reiches.
Auch der Machtverlust Roms lässt sich Ihrer Ansicht nach zum Teil auf klimatische Veränderungen zurückführen.
Ja, denn in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten trat eine massive Klimaverschlechterung ein. Es kam zu einem deutlichen Temperaturabfall, die Niederschläge nahmen stark zu, vor allem auch im Winter, was verkürzte Vegetationsperioden zur Folge hatte. In Zentralasien gab es lang anhaltende Trockenzeiten, die Weidegründe wurden immer karger. Halbnomadische Völker wie die Hunnen, die dort lebten, konnten in dieser Region nicht mehr überleben und mussten sich mit Sack und Pack aufmachen, neue Lebensräume zu finden. Durch diesen Ansturm kamen die germanischen Stämme in Nord- und Mitteleuropa in Bewegung. Die große Völkerwanderung brach los, die in der Hauptrichtung von Nordosten nach Südwesten ging. Diesem Druck der Menschenmassen und nicht dem der Heere musste das Römische Reich weichen. Es war keine militärische Niederlage Roms, sondern eine Niederlage, die verursacht war durch die Bevölkerungsmassen, die sich plötzlich in Europa verschoben haben.
Zwischen 800 und 1300 rückten vom Norden Europas immer wieder die Wikinger aus. Waren sie nur Seeräuber oder auch Siedler?
Auch da müssen wir die klimatischen Gegebenheiten beachten. Das Klima war in dieser Zeit wesentlich besser als heute; Wein gedieh sogar noch im Süden Norwegens, die landwirtschaftlichen Erträge in Skandinavien waren sehr gut. Die Bevölkerung wuchs, aber das Land konnte sich ja nicht vermehren. Daher gab es zwei Strategien. Zum einen gingen die Wikinger als Seeräuber auf Beutezüge nach Süden. Sie fuhren Flüsse wie die Seine und die Oder hoch, andere kamen bis ins Mittelmeer. Ein Teil des Bevölkerungsüberschusses wurde aber auch durch Auswanderer abgebaut, die mit Schiffen nach Island und später nach Grönland und Nordamerika kamen. Aber auch im Osten Europas bauten sie Reiche auf, wie das der Rus am Dnjepr, die heutige Ukraine. Ukraine bedeutet „das Land an der Grenze“, das stammt von dem Wort „Rain“, also der Ackergrenze. Das passt auch zum Selbstverständnis der Ukrainer, die sich nicht dem Osten, sondern dem Westen zugehörig fühlen. Der Korridor, den Nordgermanen in dieser Zeit von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer schufen, wirkt de facto noch heute als die geistige, kulturgeschichtliche Grenze zwischen Europa und Asien.
Sie sehen auch die Kreuzzüge des 12. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung.
Im hohen Mittelalter herrschten äußerst günstige klimatische Bedingungen, sodass die Bevölkerung stark anwachsen konnte. Die mittelalterlichen Klöster waren in doppelter Hinsicht ein großer Erfolg: zum einen durch die Kultivierung der Moore, wodurch ansehnliche Flächen an Neuland für die landwirtschaftliche Nutzung gewonnen wurden, zum anderen weil sie viele junge Männer und in den Nonnenklöstern auch Frauen aufnahmen. Das Kloster war das Auffangbecken für jene jungen Männer, die keine Chance auf Haus und Hof hatten. Dieser Bevölkerungsüberschuss wurde durch die Kreuzzüge in einem erheblichen Maß entlastet; denn die meisten Kreuzfahrer kamen ja nicht wieder zurück, weil sie entweder im Kampf gefallen waren oder sich in der Fremde ansiedelten.
Vom 13. bis zum 17. Jahrhundert war dann die Zeit der Katastrophen.
Ja, denn in dieser Zeit kam es zu einem massiven Temperaturabfall im Winter und zu einer Verschlechterung der Sommerwitterung. Im Winter nahm die Kälte extrem zu. Wir sprechen auch von der kleinen Eiszeit. Oft waren die großen Alpenseen, ja sogar der Bodensee, komplett zugefroren. Abwechselnd gab es völlig verregnete, dann wieder extrem heiße, trockene Sommer, was beides zu Missernten führte. Sturmfluten an den Küsten im Norden, Überschwemmungen in Mitteleuropa und soziale Unruhen kennzeichnen das Spätmittelalter. Das hatte zur Folge, dass sich ganze Volksstämme wie die Flamen, Friesen und Sachsen auf den Weg nach Südwesten machten.
Die kleine Eiszeit führte auch zu neuen politischen Konstellationen.
Genau, denn das wirtschaftliche und politische Zentrum Europas verlagerte sich nach Südwesten. Spanien und Portugal wurden in der Folge so mächtig, dass sie sich im Vertrag von Tordesillas 1494 erlauben konnten, die ganze Welt untereinander aufzuteilen. Ein unerhörter Vorgang! So haben sie sich auch die Neue Welt aufgeteilt und im Zuge einer massiven Kolonisierung enorme Menschenmengen nach Süd- und Mittelamerika verfrachtet.
Woher nahm Iberien all die Menschen, gab es da auch Zuzug aus Mitteleuropa?
Offenbar fand damals innerhalb Europas eine neue Völkerwanderung statt, eine Massenverlagerung von Menschen in weitaus größerem Ausmaß, als das historisch bisher realisiert wurde. Man kann sich ja ausrechnen, was aus Spanien und Portugal geworden wäre, wenn alle Menschen, die damals nach Süd- und Mittelamerika ausgewandert sind, nur aus diesen beiden Ländern gekommen wären; die hätten ja einen immensen Bevölkerungsschwund gehabt. Aber um die neuen Gebiete besiedeln zu können, war eine unglaubliche Menge von Menschen nötig.
Economy Ausgabe 71-03-2009, 27.03.2009
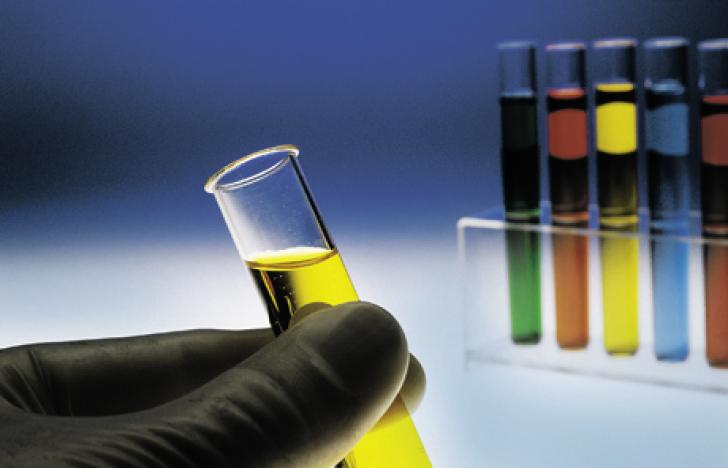 Photos.com
Photos.com







