Buchtipp
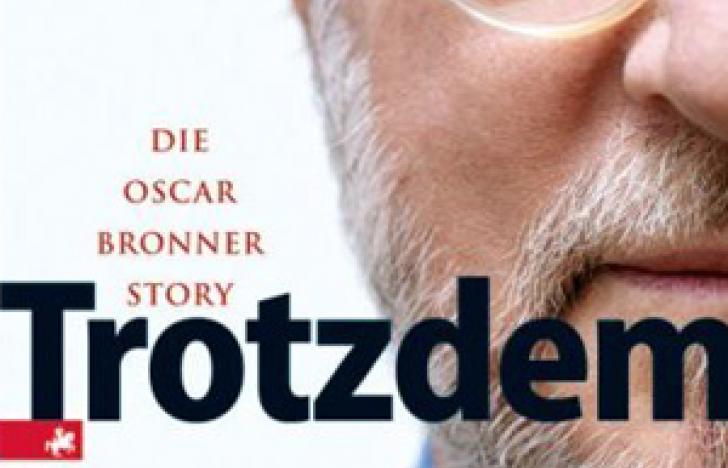 Ueberreuter
Ueberreuter„Trotzdem“ – Die Oscar Bronner Story
„Er hat Dinge getan, mit denen er dazu beigetragen hat, ein Land und seine Gesellschaft zu verändern. Er ist Wagnisse eingegangen, für die ihn andere, auch seine Freunde, stets für verrückt erklärt haben. Und auf Grund dessen er am Ende dann ebenso verlässlich alle eines Besseren belehrt hat.“ So weit der Prolog zur Oscar-Bronner-Biografie Trotzdem. Die Journalisten Klaus Stimeder (Datum) und Eva Weissenberger (Kleine Zeitung) haben Oscar Bronner zum 65. Geburtstag ein Buch über sein berufliches Lebenswerk geschenkt.
„Lebendig erzählte Zeitgeschichte, eine spannende Biografie und ein packender Wirtschaftskrimi“ steht auf dem hinteren Buch-Cover. Vorab einmal: Das stimmt. Das in vier Abschnitte aufgebaute Buch beginnt 1943 mit der Geburt von Oscar in Haifa (Israel), wohin seine Eltern Gerhard und Elisabeth Bronner im Jahre 1939 vor den Nazis geflüchtet waren. 1949 kehren die Eltern mit dem fünfjährigen Bub nach Wien zurück. Der Vater setzt seine künstlerische Karriere fort. Der junge Oscar lernt dadurch Menschen wie Helmut Qualtinger und Friedrich Torberg kennen, die ihm beide lange Jahre nahestehen. Er maturiert 1961 und wird erst beim Express, dann beim Kurier Journalist. In dieser Zeit lernt er den Express-Gründer Fritz Molden und den Aristokraten Karl Schwarzenberg kennen, die ihn beide bei seinen späteren Mediengründungen begleiten werden. Das Café Hawelka ist die Zentrale. Erika Pluhar, André Heller, Heinz Fischer, Heimito von Doderer und viele andere gehören dazu. Auch der Maler und Grafiker Kurt Moldovan, der dem nunmehrigen Wiener Bohemien ein väterlicher Freund wird und ihn mit seiner Radikalität, ausschließlich die Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen, begeistert. Sein Meisterstück als Journalist gelingt Bronner mit einer Geschichte über Staatsanwälte, die während der Nazi-Zeit viele österreichische Widerstandskämpfer zum Tode verurteilten – und ihre „Karriere“ nach Kriegs-ende fortsetzten, als ob nichts passiert wäre.
Dann 1968: Unter dem Titel Kunst und Revolution scheißt Günter Brus auf Kommando vor 300 Leuten auf das Professorenpult im Hörsaal 1 der Wiener Uni. Und Oscar Bronner, mittlerweile als zielstrebiger Einzelgänger bekannt, denkt ernsthaft über seine Zukunft nach. Mit der Gründung einer gemeinsamen Werbeagentur mit seinem Freund Jan Mariusz Demner, der baldigen beruflichen Trennung der beiden und den ersten ernsthaften Gedanken, ein
eigenes Nachrichtenmagazin wie den deutschen Spiegel zu gründen, endet der erste Teil.
Teil zwei erzählt die Gründung von Profil. Teil drei die Jahre als Maler in New York und die Rückkehr nach Wien mit dem schicksalshaften Ende in Form eines Lagerhallenbrandes am Wiener Nordbahnhof, bei dem auch der Container mit all seinen Bildern und damit 13 Jahre seines Lebens vernichtet werden. Teil vier erzählt Gründung und Entwicklung der Tageszeitung Der Standard. Aber das sollten Sie selbst lesen. Das komplette Buch ist kurzweilig, spannend und griffig geschrieben. Interessant auch für Menschen, die sich nicht primär für Medien interessieren. Es zeichnet ein stimmiges Sittenbild von Österreich und den Menschen, die dieses Land politisch und wirtschaftlich geprägt haben und prägen. Den beiden Autoren ist zu ihrem Engagement und ihrer umfangreichen Recherchetätigkeit zu gratulieren. Sie erörtern Dinge, die Bronner nie erzählen würde.
Klaus Stimeder, Eva Weissenberger: Trotzdem – Die Oscar Bronner Story Ueberreuter, 2008, 21,95 Euro ISBN: 978-3-8000-3888-6








