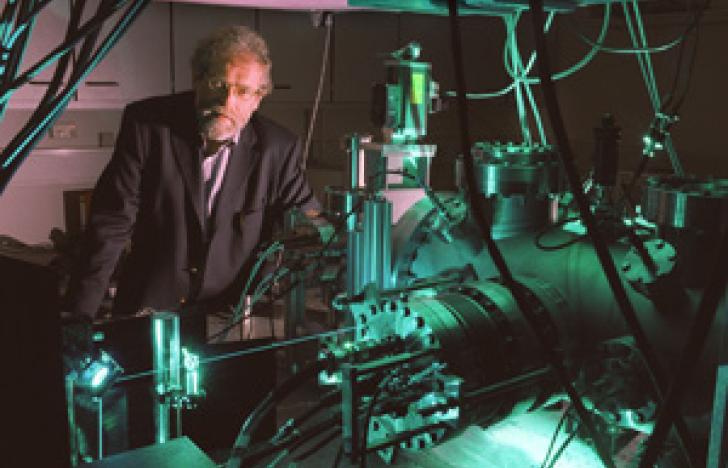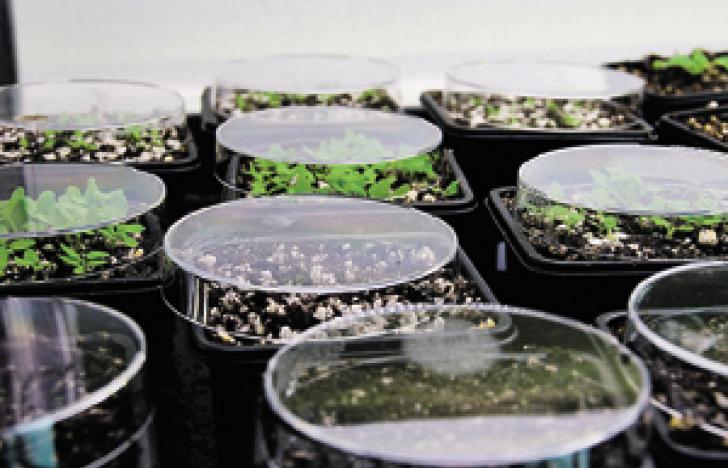„Sisyphus war ein glücklicher Mensch“
 Andy Urban
Andy UrbanBesorgniserregende Entwicklungen bei Bildungsausgaben, das hinkende Österreich und die letzte Chance für eine Neupositionierung: Hannes Androsch, Aufsichtsratspräsident der Austrian Research Centers und die Geschäftsführer Anton Plimon und Wolfgang Knoll zur Zukunft des neuen Austrian Institute of Technology (AIT).
Die Austrian Research Centers (ARC) als größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung
Österreichs haben nach einem neuen Aufsichtsratschef nun auch eine neue Geschäftsführung. Ein neuer Name mit Austrian Institute of Technology (AIT) und eine neue Ausrichtung folgen. Es ist die letzte Chance für eine Neustrukturierung und -positionierung für Seibersdorf, wie Aufsichtsratspräsident und Geschäftsführer im economy-Gespräch betonen.
economy: Ein neuer Aufsichtsratspräsident, eine neue
Geschäftsführung, der neue Name Austrian Institute of Technologies ...
Hannes Androsch: ... Herr Chefredakteur, erlauben Sie mir vorab ein kurzes Mission Statement.
Aber ja.
Androsch: Henry Ford hat vor ein paar Jahrzehnten zutreffend bemerkt: „Der Wohlstand eines Landes entscheidet sich im Klassenzimmer.“ Und seit Joseph Schumpeter (österreichischer Ökonom und Wirtschaftsphilosoph; von ihm stammt unter anderem der Begriff der schöpferischen Zerstörung, Anm. d. Red.)
wissen wir, dass Wachstum und Beschäftigung zunehmend von Bildung und Innovation abhängen. Japaner und Amerikaner wissen das, nur Europa hinkt nach, und hier hinkt Österreich nach, wie alle Rankings zeigen. Das ist besorgniserregend für die Zukunft. Noch mehr, wenn wir uns die demografische Entwicklung ansehen: deutlich mehr über 60-Jährige als unter 15-Jährige. Alles Themen, die uns im öffentlichen Diskurs zu wenig beschäftigen. Während in Europa zwischen 1995 und 2005 die Bildungsausgaben massiv gestiegen sind, sinken diese in Österreich von 6,1 Prozent auf 5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Seit 1999 sind die Uni-Budgets nominell gleich geblieben. Trotz weitaus höherer Belastungen im Zuge der Teilautonomie. Wir geben weniger als die Hälfte für unsere Unis aus als etwa die Schweiz oder Bayern. Hier besteht dringender Nachholbedarf. Innerhalb dessen haben die ARC eine ganz wichtige Rolle für Österreich. Vergleichbar mit der Fraunhofer Gesellschaft in Deutschland im wirtschaftsorientierten Bereich oder die Max Planck Gesellschaft im Bereich der Grundlagenwissenschaften. Ganz zu schweigen von Einrichtungen wie dem MIT oder der Universität Cambridge. Vor diesem Hintergrund ist die neue Ausrichtung der ARC zu verstehen. Ziel ist ein Center für Exzellenz, das hilft, mehr Verbreitung für Erfindungen und Innovationen zu bringen, in stärkerer Verbindung zur Industrie und den Unis.
Ich muss Sie zum Stichwort Unis unterbrechen: Wie sehen Sie dann die Frage der Studiengebühren?
Androsch: Die Studiengebühren haben das eingangs beschriebene Problem nicht annähernd gelöst. Wenn es zum Wegfall kommt, muss das den Unis ersetzt werden. Die Unis bekommen derzeit 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Sie brauchen das Doppelte! Da wären die 150 Millionen ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Außerdem: Bei Fachhochschulen gibt es Zugangsbeschränkungen, bei den darüberliegenden Universitäten jedoch nicht! Das hat zur Folge, dass diejenigen, die bei den FHs nicht genommen werden, an die Uni gehen. Das kann es nicht sein. Man muss das Leistungsangebot der Unis erhöhen. Dazu gehören etwa bessere Entlohnungen und neue Karriereschemen für die Lehrenden. Um Talente zu fördern, braucht es auch deutlich höhere Studienförderungen. Generell gilt: Es ist geradezu eine moralische Pflicht, die Versäumnisse der letzten zehn Jahre raschest
aufzuholen.
Im Rahmen der neuen Seibersdorf-Strategie gibt es außerdem einen neuen Finanzierungsschlüssel im Verhältnis 40 Prozent Bund, 30 Prozent Industrie und 30 Prozent Drittmittel. Damit gibt es auch eine neue Rollen- beziehungsweise Aufgabenverteilung. Welche Rolle soll das AIT im Bereich Gesellschaft, Wirtschaft und auf dem freien Markt spielen?
Anton Plimon: Der Verteilungsschlüssel zeigt es vor. Wir wissen, dass Innovation dann erfolgreich ist, wenn sie auf dem Markt erfolgreich ist. Umgekehrt braucht man Wirtschaftspartner, mit denen man langfristig arbeiten kann. Wir müssen entsprechend in der Lage sein, auch die wichtigen Themen zu erkennen und der Wirtschaft Lösungen anzubieten.
Langfristig und wirtschaftsorientiert heißt was genau?
Plimon: Langfristig bedeutet mindestens fünf Jahre. Und wirtschaftsorientiert heißt, wir suchen marktkonforme Felder, um dort Spitzenforschung möglich zu machen. Weg von der Breite, hin zur Exzellenz.
Seibersdorf hat viele erfolgreiche Geschäftsfelder, die nichts mit Technologie zu tun haben. Sehen Sie mit dem neuen Namen Austrian Institute of Technology nicht die Gefahr, dass man Seibersdorf im Markt nur mehr mit Technologie verbindet?
Plimon: Die Austrian Research Centers sind grundsätzlich stark technologieorientiert. Das gilt auch für Geschäftsfelder, die auf den ersten Blick nicht unbedingt etwas mit Technologie zu tun haben. Seibersdorf wird bald zu einem Begriff für exzellente Labordienstleistungen werden.
Androsch: Dort, wo wir Dienstleister sind, und das ist in der neuen strategischen Aufstellung auch ein wichtiger Bereich, gliedern wir die Projekte in ein neues Tochterunternehmen aus.
Sie sprechen die neue Seibersdorf Labor GmbH an, welche Projekte werden das sein?
Androsch: Zum Beispiel unsere Dopingkontrolllaboranalyse oder Hightech-Banknotenprüfsysteme.
Wie sehen Sie die zukünftige Rolle des AIT in der österreichischen Forschungslandschaft? Konkret zwischen den neuen Comet-Zentren, den Christian Doppler-Labors oder auch dem FWF.
Plimon: Das eine schließt das andere nicht aus. Auch wir können uns am Comet-Programm beteiligen oder ein CD-Labor gründen.
Androsch: In der strategischen Grundausrichtung sehen wir uns aber eine Stufe davor. Wir sind breiter oder besser gesagt tiefer aufgestellt – in Themenfindung und Struktur. Daher möchten wir auch die Nähe zu den Universitäten. Im Vergleich zu Comet ist das dann ergänzend zu sehen. Aber wie Kollege Plimon richtig sagt: Daraus kann dann auch eine Beteiligung an Comet entstehen.
Welches sind die aktuell wichtigen Forschungsgebiete?
Androsch: Life Sciences, Energieeffizienz, Nanotechnologie, Material Sciences, aber alles praxis- und umsetzungs-orientiert.
Nochmals zu Comet und zum Verhältnis zwischen den ARC und der Forschungsförderungsgesellschaft: Innerhalb der ARC hört man, dass die FFG alle Förderanträge von Seibersdorf ablehnt und das inhaltlich nicht begründet ist.
Plimon: Das betrifft nur das Comet-Programm. Hier gab es in den letzten zwei Jahren keine Erfolgsgeschichte. Es existieren hier allerdings verschiedene Zugänge bei den Prioritäten, inhaltliche Gründe, und dazu sind auch die Wirtschaftspartner ein wesentlicher Bestandteil.
Androsch: Hinzu kommt auch die Frage der Evaluierung beziehungsweise der Evaluatoren. Dazu gab es beschränkte Geldmittel. Und das Ergebnis aller dieser Faktoren war für Seibersdorf negativ. Ob zu Recht oder zu Unrecht, möchte ich jetzt nicht weiter untersuchen. Im Falle des Competence Centers an der Montan-Uni
Leoben, welches erstgereiht war und dann aufgrund der fehlenden Mittel nicht zum Zug gekommen ist, war das allerdings schmerzlich. So eine Verwaltung des Mangels brauchen wir nicht. Das gibt es eh schon zur Genüge an den Unis.
Die mangelnde Kontinuität bei der öffentlichen Forschungsförderung ist ein bekanntes Problem. Wie wird das nun bei der neuen Finanzierungsstruktur des AIT funktionieren, wo weiter 40 Prozent von öffentlichen Partnern kommen sollen?
Androsch: Einerseits müssen wir kostenschlanker werden. Andererseits zeigt sich, dass Bundesländer wie Wien und Niederösterreich ihre Verantwortung stärker wahrnehmen. Das sehen wir bei unseren dortigen Niederlassungen.
Allein beim dringend anstehenden Renovierungsbedarf des Standortes Seibersdorf ist das ein wichtiges Thema. Hier stehen Investitionen in Höhe von 15 Mio. Euro an.
Meine Frage hat die Kontinuität betroffen. Dass man intern seine Hausaufgaben macht, ist klar. Ich meine damit auch längerfristige Perspektiven für international renommierte Forscher oder auch den Wirtschaftspartnern gegenüber.
Androsch: Dafür ist das Governance-System geändert worden, was nun erlaubt, mehrjährige Zusagen zu geben. Wir gehen auch davon aus, die Zusagen über mehrere Jahre zu bekommen, weil wir entsprechend langfristig planen müssen. Ein Forschungsinstitut ist kein Schleckerli-Laden, wo man die Dinge vom Regal nimmt und bei der Kassa bezahlt.
Wolfgang Knoll: Mir ist ein wichtiger Punkt, dass es um Themen geht. Um international bestehen zu können und dazu die besten Köpfe zu bekommen und zu halten, müssen wir uns an den richtigen Themen orientieren. Wir müssen aus der Attraktivität unserer Struktur heraus den Wettbewerb bestimmen. Neben Themen geht es jungen Forschern und Forscherinnen auch um Gestaltungsfreiraum. Und wenn Sie in der Wertschöpfungskette bis hin zu einem marktreifen Produkt bestehen wollen, geht das nur über Exzellenz. Das bedingt dann auch, dass man die Themen entsprechend reduzieren muss und nur dort arbeitet, wo Exzellenz möglich ist. Ein wichtiger Punkt ist hier auch die Vernetzung mit anderen nationalen und internationalen Playern.
Wie soll der Transfer zur Wirtschaft bestmöglich passieren? Auch im Konnex zu immer wieder auftauchenden kritischen Stimmen seitens der Industrie. Von dort werden marktfähige Produkte gefordert. Sind diese aber dann da, wird das als unlautere – weil mit Steuergeld geförderte – Konkurrenz kritisiert.
Plimon: Ich denke, dieses Problempotenzial löst sich mit der neuen Labor GmbH. Damit trennen wir die Forschung von marktfertigen Produkten und Dienstleistungen, und damit hören sich dann auch gewisse Unschärfen auf. Aber natürlich, wenn wir mit Produkten auf den Markt gehen, wird uns die Industrie als Konkurrenz sehen. Wenn wir aber mit Methoden auf den Markt gehen, die der Industrie ihre Produktentwicklung ermöglichen, wird uns die Industrie als Partner sehen. Das ist genau der Weg, den wir gehen wollen. Wir werden keine Produkte allein auf den Markt bringen. Das wäre der verkehrte Weg. Das ist in der Vergangenheit passiert, und darum gab es in der Industrie verständlicherweise kritische Stimmen.
Androsch: Genau. Ob das Siemens ist, ob Magna, ob die Strabag, Amag oder KTM. Wir sind der Industrie bei der Entwicklung behilflich. Für KTM zum Beispiel hat Arsenal Research einen elektrogetriebenen, also emissionsfreien Antrieb für Geländemotoren entwickelt. Wer sagt, dass das nicht auch für Magna oder AVL-List im Bereich alternativer Auto-Antriebe ein Thema sein kann? Generell gilt aber: Suderer, um ein aktuelles Wort zu verwenden, wird es immer geben. Aus welchen Gründen auch immer. Der genannte Vorwurf geht für mich ins Leere. Im Übrigen wird auch die Industrievertretung innerhalb des neuen AIT neu aufgestellt. Mit der IV (Industriellenvereinigung Österreich, Anm. d. Red.) und interessierten Industrie-unternehmen, und die, die es nicht interessiert, werden halt nicht mehr dabei sein. Generell ist zu sagen: Für uns als neue Verantwortliche ist das eine Verantwortungsabgrenzung. Das gilt auch für den Rechnungshofbericht zu Seibersdorf. Wir haben keine Zeit für die Vergangenheit, wir müssen uns um die Zukunft kümmern.
Messkriterien für gute Forschung und das Thema Spin-offs. Ausgehend von der bisherigen Wissensbilanz, welche Pläne gibt es da?
Plimon: Es existieren aktuell sechs Spin-offs mit zusammen rund 60 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Aus unserer Sicht eine eindrucksvolle Zahl. Spin-offs werden auch weiterhin ein wichtiges Thema sein. Allerdings außerhalb der Forschungsgesellschaft. Hier gelten dann andere, marktorientierte und unternehmerische Kriterien.
Knoll: Die wissenschaftlichen Kriterien betreffend gibt es eine gute Basis. Wir sind aber nicht da, wo wir sein wollen und hinmüssen. Es geht in Zukunft nicht nur um Erkenntnisgewinnung, sondern um Technologieführerschaft.
Androsch: Es gibt den klaren Auftrag des Aufsichtsrates, Projekte bereits in ihrer Vorlaufphase zu evaluieren. Das gilt auch für grundlagenorientierte Forschungsprojekte. Bei wirtschafts- oder marktorientierten Projekten entscheidet dann ohnehin der Markt. Es wird auch eine diesbezügliche Änderung im Gesellschaftervertrag des AIT geben, damit der Aufsichtsrat eine eigene Wissenschaftsexpertise zur Projektevaluierung einholen kann. Das dient auch zur Unterstützung der Geschäftsführung.
Knoll: Ganz wichtig wird auch sein, dass zukünftig nicht mehr nur die bekannten Impact-Faktoren wie Nennungen in wichtigen wissenschaftlichen Publikationen zählen. Wissenschaftler brauchen hier auch eine neue Orientierung: mehr Profil statt mehr Publikationen. Klare Vorgaben, eine klare Strategie, wohin es gehen soll. Entscheidend wird sein: Werden wir als kompetente Mitspieler wahrgenommen? Wenn ja, zieht das entsprechende Publikationen automatisch nach sich.
Überraschend, das von einem Wissenschaftler zu hören!
Androsch: Publikationen, wenn es Sinn ergibt, ja. Aber nur wegen laber, laber – nein! Neue Eselsohren für eine Kartei zu patentieren braucht niemand. Wir brauchen keine derartigen Potemkinschen Dörfer.
Herr Knoll, wie sind die ersten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Unis?
Knoll: Ausgesprochen gut. Engagiert und inhaltlich kompetent in einem überraschend positiven Ausmaß. Wichtig ist zu vermitteln, dass es uns um den gemeinsamen Aufbau von Exzellenz geht. Erste Projekte mit der Montan-Uni, mit der Uni für Bodenkultur, der Med-Uni in Wien und der WU Wien sind bereits im Laufen. Im Vergleich zu bisherigen Perspektive hilft uns hier bereits die klare und schärfere Perspektive des neuen AIT.
Wie laufen die Engagements bei den EU-Rahmenprogrammen?
Plimon: Grundsätzlich begrüßen wir die internationalen Aktivitäten. Allerdings stellen die enormen bürokratischen Hürden ein zunehmendes Problem dar – insbesondere für unsere Partner aus der Industrie. Das realistische Abwägen von Aufwand und Erfolg ist wichtig.
Androsch: Die Kommis-sion wird gut beraten sein, den Aufwand zu straffen. Anträge gehören vereinfacht, nicht zuletzt, um den Vorwurf der Brüsseler Bürokratie entkräften zu
können.
Die Rolle des Rates für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) wird anlässlich der neuen Regierung diskutiert. Wie ist Ihre Sichtweise dazu?
Androsch: Es kommt darauf an, was die handelnden Personen daraus machen. Grundsätzlich ist so ein beratendes Organ sinnvoll. Für uns ändert das aber nichts, wir haben unsere eigenen Vorstellungen, aber für einen Rat sind wir jedem dankbar.
Welchen Zeitrahmen geben Sie sich und Seibersdorf bis zur erfolgreichen Umsetzung der neuen Strategie?
Knoll: Man muss hier einen Zeitrahmen von zwei bis drei Jahren ansetzen, bis der komplette Prozess fertig eingeführt und umgesetzt ist.
Androsch: Wir haben allen Beteiligten klar vermittelt, dass das die letzte Chance ist. Ich gehe davon aus, diese Botschaft wurde verstanden. Flurbereinigungen sind passiert, und alles Weitere ist Work in Progress. Man sagt ja auch: Sisyphus war ein glücklicher Mensch, weil er immer eine Aufgabe hatte.
Ein schöner Schlusssatz. Danke für das Gespräch.
Economy Ausgabe 68-01-2009, 01.01.2009
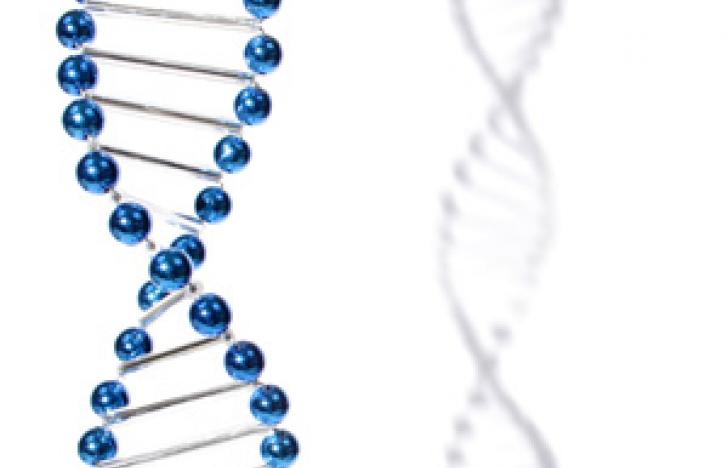 Bilderbox.com
Bilderbox.com