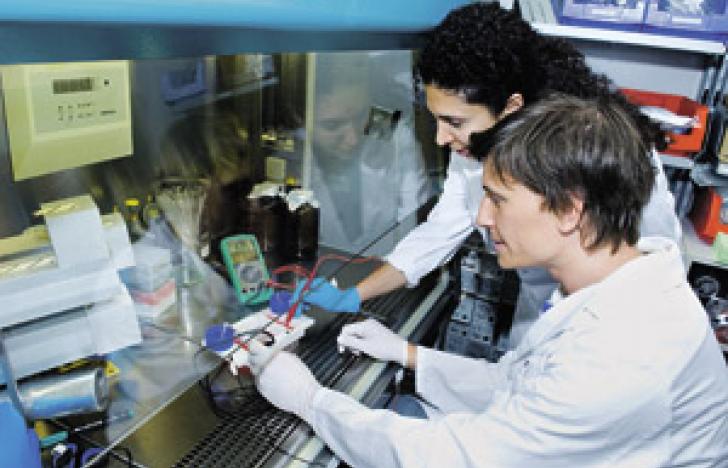Einschreiben via E-Mail
 Fotolia.com
Fotolia.comDuale Zustellung sorgt für enorme Kosten- und Zeitersparnis und garantiert ein Maximum an Sicherheit.
Seit Mitte Oktober ist es amtlich: Behördenbriefe kommen, wenn der Empfänger möchte, in Zukunft elektronisch und müssen nicht mehr von der Post abgeholt werden. Zu verdanken ist das einem Abkommen, das zwischen dem Bundeskanzleramt (BKA) und Raiffeisen Informatik geschlossen und dieser Tage der Öffentlichkeit präsentiert wurde.
Wilfried Pruschak, Geschäftsführer von Raffeisen Informatik: „Wir sind sehr stolz auf unser neues Service. Damit können Dokumente jederzeit und überall in Sekundenschnelle sicher übermittelt und garantiert an den wirklichen Adressaten zugestellt werden. Das ist nicht nur ein einfaches Mail, sondern beinhaltet alle rechtssicheren Zustellarten wie zum Beispiel RSa- und RSb-Briefe.“
Prompt und sicher
Jahr für Jahr werden in Österreich über 60 Mio. Einschreibebriefe versendet. Die elektronische Zustellung bietet aufgrund enormer Kosten- und Zeitersparnisse Behörden und Unternehmen nunmehr die Möglichkeit zu mehr Ökonomie und Effizienz. Kostet ein eingeschriebener Brief derzeit bis zu 6,85 Euro, kommt ein Einschreiben bei elektronischer Zustellung auf lediglich 95 Cent. Zustellkosten können durch die elektronische Zustellung um bis zu 90 Prozent reduziert werden. Darüber hinaus entfallen Produktions- und Transportwege, was wiederum der Umwelt
zugutekommt.
Das elektronische Zustellservice erleichtert aber auch zahlreiche und mehrheitlich zeit-intensive Amtswege. „Mit der elektronischen Zustellung ist es möglich, E-Government-Anwendungen durchgängig online durchzuführen. Behördenverfahren können von der Antragstellung bis zur Zustellung vollständig im Internet abgewickelt werden. Damit unterstützen wir auch Österreichs Vorreiterrolle im E-Government“, zeigt sich Pruschak erfreut.
Und so funktionieren die nunmehr zwei Wege der Zustellung: Bei der dualen Zustellung wird jedes Dokument an eine sogenannte Sendestation übergeben. Ist der Empfänger auf elektronischem Wege erreichbar, wird er über den Erhalt der Sendung informiert und kann das Dokument innerhalb eines bestimmten Zeitraums vom Hochsicherheitsserver abholen. Der Versender erhält eine elektronische Abholbestätigung, wenn das Dokument vom Zustellserver abgeholt wurde. Sollte der Empfänger über keinen elektronischen Briefkasten verfügen, wird das Dokument im Raiff-eisen-Output-Center gedruckt, kuvertiert und per Post zugestellt. Absender und Empfänger sind durch Registrierung und Authentifizierung eindeutig identifizierbar. Der Empfang des Schreibens ist nur mittels „qualifizierter Signatur“ möglich, und auch die Abholbestätigung muss elektronisch signiert werden. Das System der dualen Zustellung wurde vom BKA durch das E-Government-Inno-vationszentrum grundlegend geprüft – bei Implementierung und Betrieb wurde auf höchstmögliche Sicherheit geachtet. Die elektronische Zustellung der behördlichen Einschreiben erfolgt nach Paragraf 37 des Zustellgesetzes und ist damit auch rechtsverbindlich.